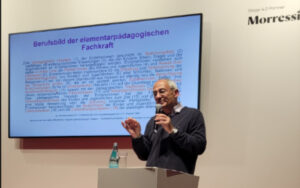BDP fordert mehr Psycholog*innen in Kitas und kindorientierte Bildung!

Frühkindliche Entwicklung als Schlüssel für mehr Bildungsgerechtigkeit – BDP plädiert für Early-Excellence-Familienzentren und psychologische Unterstützung in Kindergärten
Viele Kinder in Deutschland starten mit ungleichen Voraussetzungen ins Leben. Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) macht darauf aufmerksam, dass gerade in den ersten Lebensjahren zu wenig gezielt gefördert wird. Besonders Kinder aus benachteiligten Familien bekommen häufig nicht die Unterstützung, die sie bräuchten. Der BDP sieht darin eine verpasste Chance – für die Kinder selbst und für die Gesellschaft insgesamt. Er fordert deshalb mehr Psycholog*innen in Kindergärten und den Ausbau von Early-Excellence-Familienzentren. Hannover zeigt bereits, wie das gelingen kann. Gleichzeitig begrüßt der Verband das Startchancen-Programm der Bundesregierung, mahnt jedoch an, die Vorschulzeit stärker mitzudenken.
Frühe Jahre, große Wirkung
Bildung beginnt lange vor der Einschulung. Diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die aktuelle Stellungnahme des BDP. Anlass ist der UNICEF-Bericht 2025, der einmal mehr zeigt, wie unterschiedlich Kinder in Deutschland aufwachsen. Manche wachsen in einem Umfeld auf, in dem sie viel sprechen, spielen, entdecken und ausprobieren dürfen. Andere erleben früh Stress, Zeitdruck oder schlicht Mangel an Anregung.
Diese Unterschiede verschwinden nicht mit dem ersten Schultag. Sie prägen Kinder vielmehr dauerhaft. Sie beeinflussen, wie sicher sie sich fühlen, wie neugierig sie sind und wie selbstbewusst sie Neues angehen. Für den BDP ist deshalb klar: Wer echte Chancengerechtigkeit will, muss früher ansetzen. Nicht erst in der Schule. Sondern in der Kita und in den Familien.
Was im Kitaalter wirklich entsteht
In den ersten Lebensjahren bauen Kinder das Fundament ihres Denkens auf. Sie entwickeln innere Strukturen, mit denen sie die Welt ordnen und verstehen. Sie lernen, dass Dinge zusammenhängen, dass Handlungen Folgen haben und dass sich Probleme lösen lassen. Das geschieht nicht durch Arbeitsblätter oder Programme, sondern durch Spielen, Ausprobieren und Wiederholen.
Entscheidend ist dabei der Rahmen. Kinder brauchen Erwachsene, die aufmerksam begleiten, ohne sie zu drängen. Sie brauchen Zeit, um Dinge immer wieder zu testen. Sie brauchen Räume, in denen sie sicher scheitern und neu beginnen dürfen. Wenn diese Bedingungen stimmen, entwickeln Kinder nicht nur Wissen, sondern vor allem Lernfreude. Und genau diese Lernfreude trägt sie später durch die Schulzeit.
Der BDP betont deshalb, dass frühkindliche Bildung kein bloßes Vorspiel zur Schule ist. Sie ist ein eigener, entscheidender Bildungsabschnitt.
Early Excellence als ganzheitlicher Ansatz
Ein Modell, das genau hier ansetzt, ist der Early-Excellence-Ansatz aus England. In Deutschland wird er häufig in Form von Familienzentren innerhalb von Kindergärten umgesetzt. Der besondere Gedanke dahinter ist einfach, aber wirkungsvoll: Man kann Kinder nicht isoliert fördern, ohne ihre Lebenswelt mitzudenken.
In diesen Familienzentren wird Bildung deshalb nicht nur im Gruppenraum gedacht. Eltern werden einbezogen, beraten und unterstützt. Die Kita öffnet sich ins Quartier. Übergänge werden behutsam begleitet. Lernen wird als gemeinschaftliche Aufgabe verstanden.
Hannover gilt hier als Vorreiter. Mit 51 Early-Excellence-Familienzentren hat die Stadt ein Netz geschaffen, das Kinder und Familien gleichermaßen stärkt. Für den BDP ist Hannover ein Beleg dafür, dass dieser Ansatz funktioniert – und bundesweit Schule machen sollte.
Warum Psycholog*innen in Kitas gebraucht werden
Erzieherinnen leisten jeden Tag wertvolle Arbeit. Dennoch stoßen sie zunehmend an Grenzen. Die Gruppen sind groß, die Aufgaben vielfältig und die Bedürfnisse der Kinder sehr unterschiedlich. Genau hier sieht der BDP den Bedarf an Psychologinnen in Kindergärten.
Diese könnten Kinder gezielt unterstützen, wenn sie Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, zu regulieren oder in der Gruppe zurechtzukommen. Sie könnten Teams dabei helfen, Lernräume so zu gestalten, dass sie Kinder nicht über-, aber auch nicht unterfordern. Und sie könnten Eltern begleiten, wenn Unsicherheiten oder Belastungen auftreten.
Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Kitas zu Therapieräumen zu machen. Es geht um Prävention. Um frühe Hilfe. Um bessere Bedingungen, bevor Probleme größer werden. Aus Sicht des BDP wäre dies ein wichtiger Schritt hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit.
Startchancen – guter Impuls, aber zu spät gedacht
Der BDP begrüßt das Startchancen-Programm der Bundesregierung als grundsätzlich richtigen Schritt. Es zeigt, dass Bildungsgerechtigkeit endlich stärker in den Fokus rückt. Gleichzeitig hält der Verband den Ansatz für zu schullastig.
Denn viele Weichen werden bereits gestellt, bevor ein Kind überhaupt einen Klassenraum betritt. In der Kita. In der Familie. In den ersten Lebensjahren. Wenn diese Phase nicht ausreichend berücksichtigt wird, bleiben spätere Maßnahmen oft weniger wirksam, als sie sein könnten.
Der BDP plädiert deshalb für einen stärkeren Blick auf die Frühförderung. Für mehr Early-Excellence-Familienzentren. Für bessere strukturelle Bedingungen in Kitas. Und für die verbindliche Einbindung von Psycholog*innen in die frühkindliche Bildung.
Am Ende läuft alles auf eine einfache Erkenntnis hinaus: Wer Kinder stark machen will, muss früh beginnen.