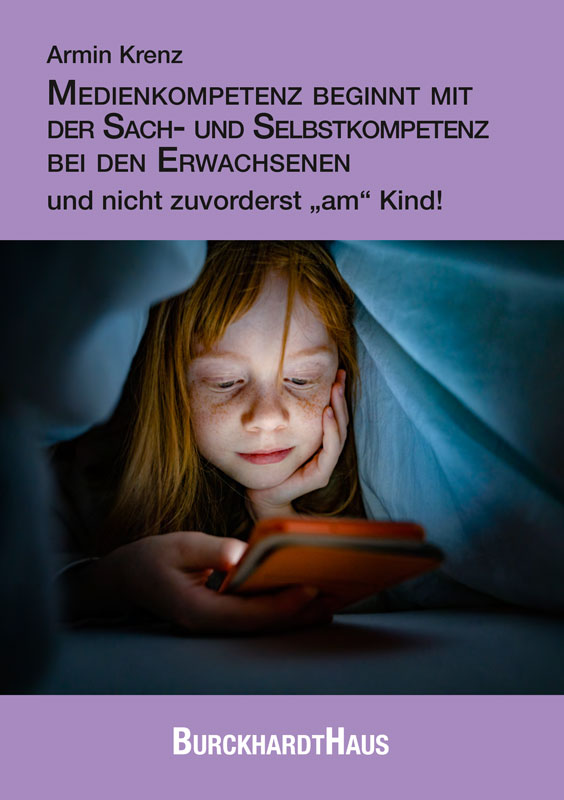Arbeitsgedächtnistraining steigert Leistungen und bessert Bildungswege

Langfristige Effekte einer im Unterricht verankerten Intervention bei Erstklässlern
Kinder, die bereits in der ersten Klasse gezielt ihr Arbeitsgedächtnis trainieren, profitieren langfristig nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen schulischen und kognitiven Fähigkeiten. Das zeigt eine groß angelegte Feldstudie, geleitet von Ernst Fehr, Professor für Mikroökonomik und experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Zürich sowie Direktor des UBS International Center of Economics in Society. Gemeinsam mit Eva M. Berger, Henning Hermes, Daniel Schunk und Kirsten Winkel untersuchte er die kausalen Auswirkungen eines in den regulären Schulunterricht eingebetteten Arbeitsgedächtnistrainings bei 6- bis 7-jährigen Grundschulkindern.
„Wir stellen erhebliche Zuwächse bei der WM-Kapazität fest und dokumentieren positive Spillover-Effekte auf Geometrie, fluiden IQ und inhibitorische Kontrolle“, so die Autorinnen und Autoren. Drei Jahre nach Abschluss der Intervention war die Wahrscheinlichkeit, dass die teilnehmenden Kinder einen akademischen Bildungsweg einschlagen, um 16 Prozentpunkte höher als in der Kontrollgruppe.
Fünf Wochen Training im Schulalltag
Das Training erstreckte sich über 25 aufeinanderfolgende Schultage und wurde anstelle des regulären Unterrichts in Mathematik oder Deutsch in einer der ersten beiden Stunden durchgeführt. Die Kinder erhielten eine Reihe strukturierter Übungen, die von den Lehrkräften als normale Unterrichtseinheit präsentiert wurden. „Die Kinder in der Versuchsgruppe wussten nicht, dass sie an einem Experiment teilnahmen“, betonen die Forschenden.
Diese Einbettung in den Schulalltag sorgte für hohe Akzeptanz bei Kindern und Lehrkräften. Dass dabei 25 Unterrichtsstunden in den Hauptfächern ersetzt wurden, erwies sich nicht als Nachteil. Im Gegenteil: „Unsere Behandlungseffekte beinhalten bereits die Opportunitätskosten der versäumten Schulstunden. Das bedeutet, dass die Kinder einen Nettonutzen aus dem WM-Training gezogen haben.“
Langsame, aber nachhaltige Wirkung
Während sich Verbesserungen im Arbeitsgedächtnis sofort nach dem Training zeigten, traten andere Effekte erst mit zeitlichem Abstand auf. „Die Spillover-Effekte treten nicht kurzfristig auf. Stattdessen zeigen sie im Verlauf mehrerer Evaluierungswellen ein steigendes Muster.“
Nach sechs Monaten wurden Fortschritte in Geometrie und im fluiden IQ messbar, nach zwölf bis dreizehn Monaten kam eine Verbesserung der inhibitorischen Kontrolle hinzu – also der Fähigkeit, impulsive Reaktionen zu hemmen. Die Effektstärken in diesen Bereichen lagen zwischen 0,24 und 0,38 Standardabweichungen.
Warum frühe Förderung wirkt
Die Forschenden führen die Erfolge auch auf die hohe Plastizität des kindlichen Gehirns in diesem Alter zurück. Früh erworbene Fähigkeiten erleichtern den Erwerb weiterer Kompetenzen – ein Prozess, den die Bildungsökonomie als Selbstproduktivität und dynamische Komplementarität beschreibt. „In einer Phase erworbene Qualifikationen erhöhen die in späteren Phasen erworbenen Qualifikationen“, heißt es in der Studie.
Bedeutung für die Praxis
Für Lehrkräfte macht die Untersuchung deutlich, dass gezielte Förderung exekutiver Funktionen wie des Arbeitsgedächtnisses nicht nur kurzfristige Lerneffekte bringen kann, sondern langfristig den gesamten Bildungsweg beeinflusst. Entscheidend ist dabei die Integration in den regulären Unterricht und die kontinuierliche Durchführung über mehrere Wochen.
Quelle:
Berger, Eva M.; Fehr, Ernst; Hermes, Henning; Schunk, Daniel; Winkel, Kirsten (2025): The Causal Effects of Working Memory Training on Cognitive and Noncognitive Skills in Children. Journal of Political Economy, 133(2), The University of Chicago Press.