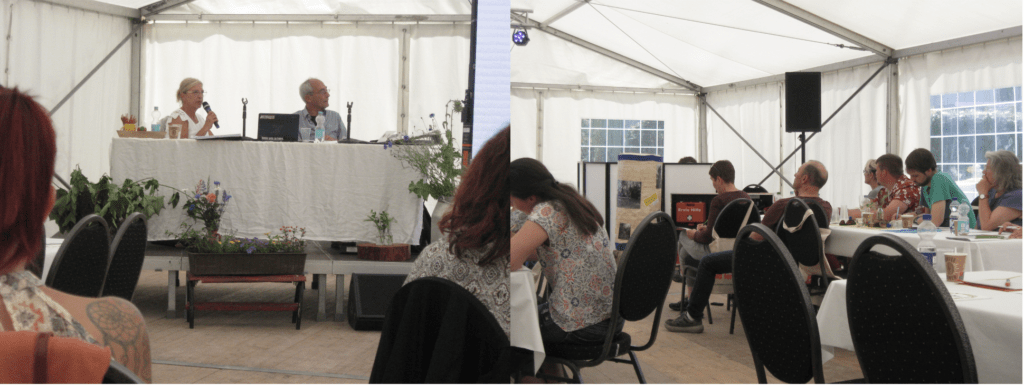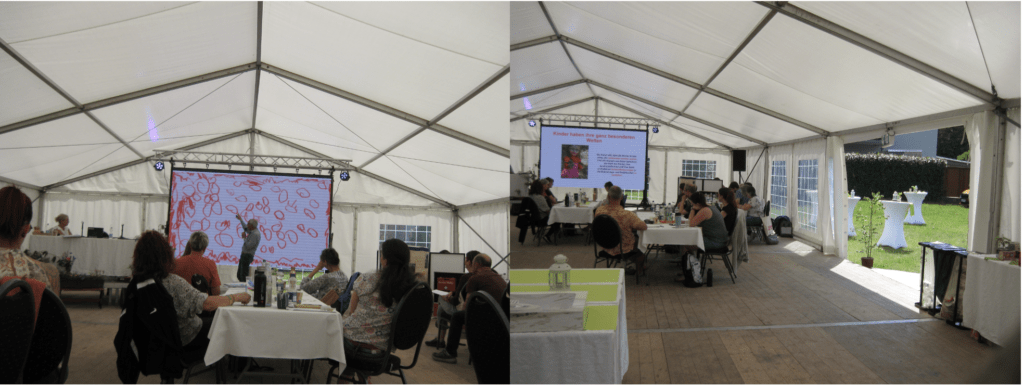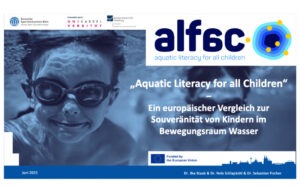Werde Teil unseres Teams in der Kita an der Löwenbrücke!
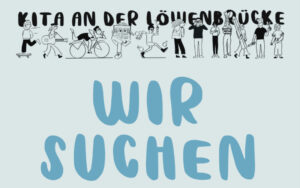
Die Kita an der Löwenbrücke in Würzburg sucht eine pädagogische Fachkraft
Wir suchen DICH!
Erzieherin / pädagogische Fachkraft oder Ergänzungskraft / Heilerziehungspflegerin (m/w/d)
in Teil- oder Vollzeit für unsere Kindergartengruppe – ab Juli 2025 oder später, spätestens zum September 2025
Wer wir sind:
Die Kita an der Löwenbrücke ist eine Elterninitiative mit Herz, gelegen in Würzburg. Wir betreuen 51 Kindergarten- und 13 Krippenkinder in einer familiären, offenen Atmosphäre. Als Mitglied im Evangelischen KITA-Verband Bayern und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband legen wir besonderen Wert auf Bildung durch Bewegung und ein offenes pädagogisches Konzept.
Was wir dir bieten:
- Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem sympathischen, aufgeschlossenen Team
- Ein wertschätzendes, offenes Arbeitsklima
- Eine abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit
- Regelmäßige Teamsitzungen und Supervision
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Bezahlung in Anlehnung an den TVöD-SuE
- Jobrad oder Jobticket
Deine Aufgaben:
- Bildung, Betreuung, Erziehung und Pflege der Kinder
- Aktive Teilnahme an Teamsitzungen und internen Besprechungen
- Zusammenarbeit mit den Eltern (inkl. Beobachtungsdokumentation und Elterngesprächen)
- Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts und Kinderschutzkonzepts
Das wünschen wir uns von dir:
- Einen staatlich anerkannten pädagogischen Abschluss
- Fundiertes Fachwissen und pädagogische Kompetenz
- Einfühlungsvermögen und einen liebevollen Umgang mit Kindern
- Kreativität, Organisationstalent und eine strukturierte Arbeitsweise
- Engagement, Geduld und Teamfähigkeit
- Kommunikationsstärke und Flexibilität
Klingt gut? Dann bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – gerne per E-Mail an:
📧 bewerbung@kita-wuerzburg.de
Kita an der Löwenbrücke
Studentische Kindertagesstätte e.V.
Mergentheimer Straße 7b · 97082 Würzburg
Weitere Informationen findest du auf unserer Website:
🌐 www.kita-wuerzburg.de