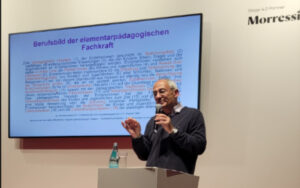Bessere Sprachentwicklung in Kita: Mehr Beobachten statt bloßer Tests!

Neue interdisziplinäre Expertise zeigt: Sprachentwicklung gelingt vor allem durch alltagsintegrierte Bildung, qualifizierte Beobachtung und bessere Vernetzung – nicht durch flächendeckende Screenings
Die jüngst erschienene Expertise zur Erfassung und Förderung der sprachlichen Entwicklung in der Kindertagesbetreuung zeichnet ein ambivalentes Bild: In deutschen Kitas wird sehr viel beobachtet, dokumentiert und getestet – doch die vorhandenen Daten führen häufig nicht zu besserer Unterstützung für Kinder. Stattdessen dominieren punktuelle Messungen, die wenig über tatsächliche Entwicklungsverläufe aussagen und kaum handlungsleitend für die pädagogische Praxis sind.
Die Autor*innen betonen, dass Sprache kein isolierbares „Testmerkmal“ ist, sondern sich in Beziehungen, Alltagssituationen und sozialen Kontexten entwickelt. Strukturelle Probleme wie Fachkräftemangel, große Gruppen und fehlende Zeit erschweren es Kitas zusätzlich, Beobachtungen systematisch auszuwerten und in passgenaue Sprachbildungsangebote zu überführen. Gleichzeitig werden viele Verfahren eingesetzt – in NRW durchschnittlich vier pro Einrichtung –, ohne dass ihre Ergebnisse sinnvoll miteinander verknüpft werden.
Beobachtung statt Momentaufnahme: Was wirklich trägt
Im Zentrum der Empfehlungen steht die kontinuierliche, systematische Beobachtung als zentrales Instrument der Sprachstandserfassung. Offene Verfahren wie Bildungs- und Lerngeschichten oder wahrnehmende Beobachtung erlauben einen ganzheitlichen Blick auf Kinder, ihre Interessen, Kommunikationsweisen und Lernwege. Standardisierte Bögen wie BaSiK, Seldak oder Sismik können dies ergänzen, ersetzen aber nicht den Blick auf den Alltag des Kindes.
Entscheidend ist, dass Beobachtungen nicht nur dokumentiert, sondern konsequent in pädagogisches Handeln übersetzt werden: Welche sprachlichen Anregungen braucht dieses Kind? Welche Situationen fördern Dialog? Welche Umgebung unterstützt konzentriertes Sprechen und Zuhören? Dafür braucht es gut qualifizierte Fachkräfte, regelmäßige Reflexion und ausreichende Zeitressourcen.
Warum Sprachscreenings überschätzt werden
Sprachscreenings werden in der politischen Debatte oft als Lösung präsentiert – etwa im Kontext der geplanten verpflichtenden Sprachdiagnostik für Vierjährige. Die Expertise zeigt jedoch klar ihre Grenzen: Screenings liefern nur Momentaufnahmen, sind anfällig für falsch-positive Ergebnisse und bieten kaum Hinweise für konkrete Förderung.
Besonders problematisch ist ihr Einsatz bei mehrsprachigen Kindern. Viele Verfahren basieren auf einsprachigen Altersnormen und deuten typische Merkmale des Zweitspracherwerbs fälschlich als „Defizit“. Dadurch besteht die Gefahr von Stigmatisierung, Fehlzuweisungen zu Fördermaßnahmen oder sogar ungerechtfertigten Schulrückstellungen.
Alltagsintegrierte Sprachbildung ist am wirksamsten
Statt additiver Förderprogramme in separaten Settings plädiert die Expertise für eine bedarfsorientierte, alltagsintegrierte Sprachbildung. Kinder lernen Sprache am besten in authentischen, interessengeleiteten Interaktionen – beim Spielen, Erzählen, Forschen und gemeinsamen Handeln.
Wirksame Praxis bedeutet daher:
- dialogische, beziehungsorientierte Kommunikation,
- eine ruhige, strukturierte und sprachlich anregende Umgebung,
- Wertschätzung von Mehrsprachigkeit als Ressource,
- gezielte Zusammenarbeit mit Familien,
- und professionelle Fachberatung für Kitas.
Additive Programme können ergänzen, ersetzen aber nicht gute pädagogische Prozessqualität.
Logopädische Diagnostik: notwendig – aber oft zu spät
Bei auffälligen Entwicklungsverläufen ist eine frühzeitige, mehrdimensionale logopädische Diagnostik unerlässlich. Sie sollte alle Sprachen des Kindes einbeziehen und medizinische Aspekte wie Hörfähigkeit berücksichtigen.
In der Realität behindern jedoch lange Wartezeiten, regionale Versorgungslücken und fehlende Dolmetschangebote eine zeitnahe Abklärung. Dies erhöht das Risiko von Fehldiagnosen und verspäteten Interventionen – mit langfristigen Folgen für die Bildungsbiografie der Kinder.
Vernetzung als Schlüssel zur besseren Sprachbildung
Ein zentrales Ergebnis der Expertise ist die Notwendigkeit stärkerer multiprofessioneller Kooperation zwischen Kita, Kinderärzt*innen, Logopädie, Frühförderstellen und Jugendhilfe – immer in enger Abstimmung mit den Familien.
Empfohlen werden unter anderem:
- bessere Schnittstellen für den Informationsaustausch,
- Ausbau diagnostischer und therapeutischer Kapazitäten,
- rechtliche Erleichterungen für Sprachtherapie in Kitas,
- anschlussfähige Übergänge von der Kita zur Grundschule,
- und die Verstetigung erfolgreicher Modellprojekte.
Weg vom Defizitblick, hin zu chancengerechter Sprachbildung
Die Expertise fordert einen Paradigmenwechsel: Weg von defizitorientierter „Sprachförderung“, hin zu einer inklusiven, ressourcenorientierten Sprachbildung, die jedes Kind in seiner individuellen Entwicklung ernst nimmt.
Nicht mehr Tests sind der Schlüssel – sondern bessere Rahmenbedingungen, qualifizierte Fachkräfte und eine enge Verzahnung von Bildung, Gesundheit und Familie. Nur so kann sprachliche Bildung nachhaltig gelingen und echte Bildungsgerechtigkeit entstehen. Quelle: Espenhorst, N., Koch, S., Albers, T., Cloos, P., Glück, C., Hruška, C. A., & Scharff Rethfeldt, W. (2026): Erfassung und Förderung der sprachlichen Entwicklung im Kontext der Kindertagesbetreuung. Handlungsempfehlungen für geeignete Maßnahmen und Konzepte aus interdisziplinärer Sicht. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.