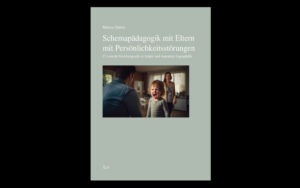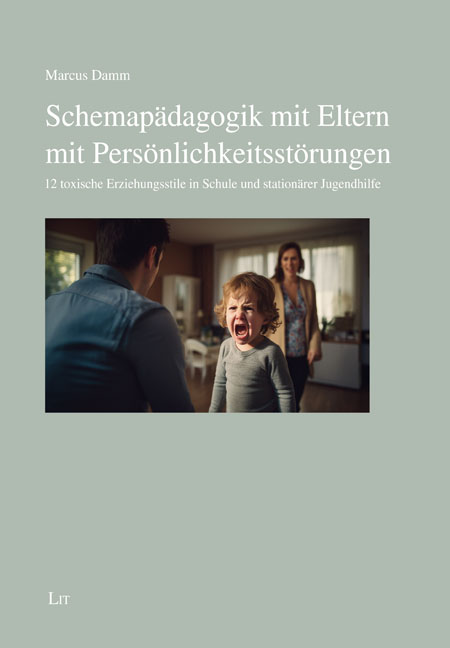Nie war der Safer Internet Day wichtiger als jetzt!
Immer mehr falsche und gefälschte, populistische und extremistische Inhalte finden sich auf allen Internet-Kanälen, vor allem in Social Media Feeds. Das stellt besonders Kinder und Jugendliche vor große Herausforderungen, Informationen und News souverän zu bewerten und kritisch einzuordnen. Junge Menschen sind rund dreieinhalb Stunden täglich online und informieren sich in sozialen Medien über das aktuelle Weltgeschehen. Das bestätigt die JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) 2024. 61 Prozent der befragten Jugendlichen wurden online bereits mit Fake News, 54 Prozent mit extremen politischen Ansichten und 43 Prozent mit Verschwörungserzählungen konfrontiert (JIM-Studie 2024).
„Die Zahlen der JIM-Studie belegen, dass Kinder und Jugendliche schon früh mit Fake News und Extremismus konfrontiert werden“, erläutert Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. „Gerade die großen Plattformen werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Zum Safer Internet Day setzt unsere EU-Initiative klicksafe deshalb eine klare Botschaft: „Keine Likes für Lügen!“.
„Wo Rechtsextreme hetzen, Meinungen statt Fakten gelten und Politikverdruss demokratiefeindlichen Beiträgen zu großer Reichweite verhilft, brauchen wir Medienkompetenz mehr denn je“, sagt Deborah Woldemichael, Leiterin der EU-Initiative klicksafe bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.
Kampagne „Keine Likes für Lügen! Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz“
Mit der Kampagne „Keine Likes für Lügen! Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz“ und einer umfassenden Medienkompetenz-Offensive stellt klicksafe zum diesjährigen Safer Internet Day (SID25) am 11. Februar den Schutz, die Aufklärung und das Empowerment junger Menschen in den Fokus. Anlässlich des Safer Internet Days bieten klicksafe und die Partner des Verbunds Safer Internet DE vielfältige Informationsangebote und Materialien für Lehrkräfte, Eltern und Jugendliche. Im Rahmen einer Fach- und Presseveranstaltung am 11. Februar in Berlin finden Workshops und eine Paneldiskussion mit Schüler*innen, Expert*innen, Influencer*innen und Politik statt. Ein weiteres Highlight ist die digitale Schulstunde am Safer Internet Day zum Motto „Keine Likes für Lügen!“. Zu dieser können sich alle Schulen bundesweit anmelden und online teilnehmen.
Bundesweite Veranstaltungen und digitale Angebote den ganzen Februar – jetzt mitmachen!
Der Safer Internet Day lebt von seinen vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen. klicksafe ruft deutschlandweit daher Institutionen, Stiftungen, Unternehmen, Schulen, Jugendorganisationen, Bildungseinrichtungen, Vereine und auch Privatpersonen dazu auf, sich mit eigenen Beiträgen und Projekten am Safer Internet Day zu beteiligen – gemeinsam für ein besseres und sichereres Internet zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Zum ersten Mal können Aktionen und Aktivitäten den ganzen Februar unter der Marke Safer Internet Day veranstaltet werden.
Die Möglichkeiten der Beteiligung sind vielfältig
Veranstalter können ihre Events und Aktionen bei klicksafe anmelden. Alle eingetragenen Aktionen sind damit in der deutschlandweiten und interaktiven Veranstaltungskarte sichtbar und werden beworben. Wer nicht selbst anbietet, sondern an Veranstaltungen teilnehmen möchte, wird mit der Karte ebenfalls fündig. Bereits über 100 Aktionsteilnehmer*innen haben sich mit ihren Veranstaltungen angemeldet. Viele davon können online besucht werden. Für eine breite Aufmerksamkeit rund um den Safer Internet Day und die Kampagne „Keine Likes für Lügen!“ stehen Plakate, Sticker, Profilbildgenerator und Sharepics zum Download bereit. Wer Informationen sucht oder mitreden und mitdiskutieren möchte, findet in den sozialen Netzwerken unter den Hashtags #SID2025, #SID25, #KeineLikesfürLügen viele interessante Beiträge und Diskussionen. Machen Sie jetzt mit!
Eröffnung des Safer Internet Day 2025
Am 11. Februar 2025 von 9.45 bis 10.00 Uhr findet die Eröffnung des Safer Internet Day 2025 im Media:TURM Ludwigshafen durch Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, und Heike Raab, Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz statt.
Am 11. Februar 2025 von 10.00 bis 11.30 Uhr lädt klicksafe bundesweit alle Schulen mit Schülerinnen der Klassenstufen 8 bis 10 zu einer digitalen Schulstunde ein. Die Schülerinnen lernen die Onlinestrategien von rechtsextremem Akteurinnen kennen. Sie erfahren auf aktivierende und praxisorientierte Weise, welche Auswirkungen Desinformationen auf den Einzelnen und die Gesellschaft hat. Expertinnen der Medienpädagogik und des Jugendmedienschutzes von klicksafe und jugendschutz.net vermitteln den Jugendlichen aktuelles Wissen sowie wichtige Hintergründe.
Aktuelle Fallbeispiele regen die Schülerinnen dabei zum Nachdenken an. Durch interaktive Live-Umfragen und die Möglichkeit, Fragen vorab oder via moderierten Chat zu stellen, sind die Teilnehmenden aktiv an der Veranstaltung beteiligt. Darüber hinaus sind alle Teilnehmerinnen in zwei Gruppenarbeitsphasen selbst gefragt und entwickeln digitale Zivilcourage für den souveränen Umgang mit demokratiefeindlichen Informationen im Netz. So entsteht ein abwechslungsreicher Lernprozess, der Wissen und Handlungskompetenz gleichermaßen stärkt. Aufgezeichnet wird die digitale Schulstunde im Media:TURM Ludwigshafen. Die digitale Schulstunde ist eine Aktion des Verbunds „Safer Internet DE“.
Schulen aus ganz Deutschland können sich hier für die digitale Schulstunde anmelden.
Medienpädagogische Materialien zum Thema
klicksafe bietet zum Themenschwerpunkt des Safer Internet Days umfangreiche neue Materialien für pädagogische Fachkräfte, für Jugendliche sowie für Eltern und Familien an. Ab sofort ist das Lehrmaterial „Rechts.Extrem.Online.” zum Download verfügbar, welches fundierte Sachinformationen und pädagogisch aufbereitete Unterrichtseinheiten bietet. Für die pädagogische Praxis in und außerhalb der Schule wird in Kürze ein informativer Actionbound für Jugendliche mit dem Titel „#cleanyournetwork“ zur Verfügung stehen. Flankiert wird das Bildungsangebot von einer Broschüre für Eltern und Familien mit vielen praktischen Tipps und wertvollen Informationen im Umgang mit Rechtsextremismus im Netz. Zusätzlich wird klicksafe in den kommenden Wochen Info-Karten und Expertentalks zum Thema zur Verfügung stellen.
Das Lehrmaterial steht ab sofort zum Download bereit.
Alle wichtigen Links und kompakte Informationen finden Sie hier
Über den Safer Internet Day
Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Woche im Februar statt. Er setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos „Together for a better internet“. In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert.
Über klicksafe
klicksafe ist die Medienkompetenz-Initiative der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Netz. Mit vielfältigen Angeboten unterstützt klicksafe beim souveränen und kritischen Umgang mit digitalen Medien. Auf klicksafe.de finden pädagogische Fachkräfte, Eltern und interessierte Nutzer*innen aktuelle Informationen und Materialien.
Quelle: Pressemitteilung klicksave