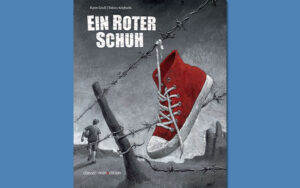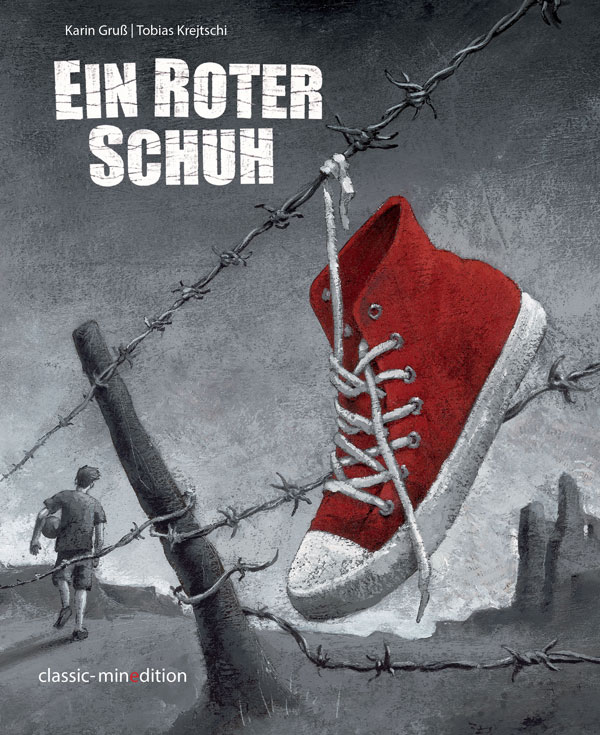Wird 2024 zum Jahr der großen Bildungswende?

Die neue KMK Präsidentin will das Bildungssystem mutig verändern – was ihr entgegensteht
Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Christine Streichert-Clivot (Foto), will das Bildungssystem mutig verändern. Gegenüber dem Deutschlandfunk erklärt die saarländische Bildungsministerin, dass man bereits begonnen habe, den Fokus auf den Erwerb von Basiskompetenzen zu legen. Das will sie gemeinsam mit den Akteuren aus dem Bildungssystem tun. Allein schaffe das die Schule ohnehin nicht. Es brauche eine Zusammenarbeit über die Ressortgrenzen hinaus. Helfen solle dabei das Startchancenprogramm, das ab Herbst nun endlich helfen solle, multiple Problemlagen zu lösen.
Laut Studien ist unser Bildugnssystem so schlecht wie nie zuvor
Irgendwie haben wir das alles schon mal gehört. Seit dem ersten PISA-Schock zur Jahrtausendwende gab es in regelmäßigen Abständen großartige Ankündigungen, dass sich nun alles bessern werde. Dabei ist offensichtlich kaum etwas besser geworden, sondern vieles schlechter. Belege dafür gab es im vergangenen Jahr genug. Mit Blick auf die Ergebnisse der PISA-, IQB- und IGLU-Studien zeigt sich deutlich, dass unser Bildungssystem zu einem leckenden Wrack verkommen ist.

An Kompetenz mangelt es nicht
Dabei mangelt es gar nicht am Wissen. Über die Entwicklung des Menschen und das Lernen ist fast alles bekannt. Auch mangelt es nicht an gelungenen Beispielen: Mit dem jährlich vergebenen Schulpreis gibt es aktuell über 100 Schulen zu bestaunen, in denen lehren und lernen bekanntlich gelingt. Was läuft auf Politikseite also schief, dass es trotz vielfältiger Bemühungen in den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen ist, ein funktionierendes Bildungssystem aufzubauen?
Veränderung ist schwer und manchem zu schwer
„Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch und am Ende wunderschön“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Wer unser Bildungssystem nur ansatzweise kennt, weiß, wie schwer es ist, die verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Die Nutznießerinnen und Nutznießer des Systems sind nicht nur mächtig, sondern verteidigen es auch mit fast allen Mitteln. Die meisten Reformbemühungen von Politikseite scheitern schon im Ansatz, weil zahlreiche Politikerinnen und Politiker die Interessen ihres Klientels, das sie in ihrer Position stützt, vertreten. Es versteht sich, dass Kinder so gut wie nie zu diesem Klientel gehören. So ersticken schon die meisten sinnvollen Initiativen im Parteienstreit oder scheitern an der Bürokratie.
Expertentum statt Lobbyismus ist überfällig
Leider gilt der Spruch nicht: „Wem Gott gibt ein Amt, dem schenkt er auch den Verstand“. Die meisten Ministerinnen und Minister sind nicht vom Fach. Christine Streichert-Clivot hat etwa sieben Jahre lang Politikwissenschaft, Soziologie und Volkswirtschaftslehre studiert, aber eben kein Lehramt oder Pädagogik. Das ist durchaus üblich. Schließlich geht es in diesem Amt erst mal darum, mit dem Ministerium klar zu kommen. Die Bildung kommt dann erst an zweiter Stelle.
Um diesen Nachteil auszugleichen, haben viele Politikerinnen und Politiker Fachberaterinnen und -berater. Leider verwechseln sie diese allzu leicht mit den Lobbyisten. So spricht Streichert-Clivot von den Akteuren aus dem Bildungssystem. Viele von diesen sind in Verbänden, Stiftungen oder Vereinen tätig, die keineswegs an erster Stelle die Interessen der Kinder und Jugendlichen vertreten. So ist etwa der didacta Verband kein Verband, der sich in erster Linie für eine gelungene Bildung oder Pädagogik engagiert. Als Verband der Bildungswirtschaft vertritt er die Interessen seiner Mitglieder und als Wirtschaftsunternehmen haben diese völlig legitim ihre Profitinteressen im Auge.
Gleiches gilt etwa für den Verband der Bildungsmedien oder – aus unserer Sicht – für die Stiftung Lesen, deren Mitglieder bzw. Stifterrat zum Großteil Wirtschaftsunternehmen sind. Auch die Gewerkschaften, der Realschullehrerverband oder der Philologenverband haben in erster Linie die Interessen ihrer Mitglieder im Auge und das sind eben nicht die Schülerinnen und Schüler. Gleiches gilt auch für die zahlreichen Bildungsträger, die oftmals zumindest die Interessen der Eltern berücksichtigen. In all den beschriebenen Vereinigungen gibt es zwar tatsächlich engagierte Menschen, die sich ehrlich für die Belange der Kinder und Jugendlichen einsetzen. Im Zweifel jedoch stehen die eigentlichen Interessen dieser Organisationen für den wirtschaftlichen Erfolg oder den Erfolg der Mitglieder an erster Stelle.
An den Früchten sollt ihr sie erkennen
Es bedarf schon einiger Mühe tatsächliche Expertinnen und Experten zu identifizieren, die vorwiegend darauf zielen, die Bildung von Kindern und Jugendlichen unterstützen wollen. An erster Stelle seien hier die tatsächlichen Forscherinnen und Forscher genannt, die sich leider nicht durch den Professoren- oder Doktortitel identifizieren lassen, sondern durch ihre konkrete Arbeit. Und diese leisten sie nicht auf Empfängen mit dem Sektglas in der Hand. Hier sollte der gesunde Menschenverstand helfen.
Auch der Deutsche Kinderschutzbund oder das Deutsche Kinderhilfswerk engagieren sich ehrlich für die Interessen der Kinder- und Jugendlichen, nur eben selten auf der Bildungsseite. Eine rühmliche Ausnahme bildet der Grundschulverband, der sich zum Ziel gesetzt hat, die berechtigten pädagogischen Interessen der Kinder zu vertreten.
Zu viel steht auf dem Spiel
Wer diese Prozesse versteht, der möchte manchmal einfach davonlaufen, kapitulieren oder schlimmeres tun. Schließlich skizzieren die oben beschriebenen Mechanismen einige Ursachen dafür, warum sich entweder nichts bewegt oder einfach in die falsche Richtung agiert wird. Andererseits gilt es, den kritischen Blick zu schärfen, um jenen besser auf die Finger zu schauen, die solche Prozesse in Gang setzen und durchführen. Den Ehrlichen wird es recht sein. Alle anderen mögen das gar nicht. Kneifen gilt aber nicht. Schließlich lassen sich die meisten Missstände in demokratischen Staaten auf einen Mangel an Bildung zurückführen. Der Schlüssel liegt also in einem menschengerechten, wertschätzenden, modernen Bildungssystem.
Es wird also spannend sein, zu beobachten, mit welchen Akteuren aus dem Bildungssystem Streichert-Clivot zusammenarbeiten will, und wo diese dann noch aktiv sind.
Veränderung bedeutet immer auch Widerstand
Die neue KMK-Präsidentin muss wirklich sehr mutig sein, wenn sie etwas nachhaltig zum Guten verändern möchte. Schließlich gilt es zunächst viele alte Zöpfe abzuschneiden, die in den vergangenen 30 Jahren nun schon kläglich versagt haben und uns in diese Katastrophe geführt haben. Das wird Ärger geben. Dabei wird sie zwar auf vielseitiges Verständnis stoßen, ehrliche Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden, wird ihr dagegen schwerfallen. In jedem Fall sollte sie die Kinder und Jugendlichen hören und jene Akteure im Bildungssystem, die in den vergangenen Jahren den Schulpreis erhalten haben.
Als unabhängiges und kritisches Pressemedium werden wir diesen Prozess begleiten, Sie informieren, das schlecht nennen, was schlecht ist, und das loben, was zu loben ist.
Gernot Körner