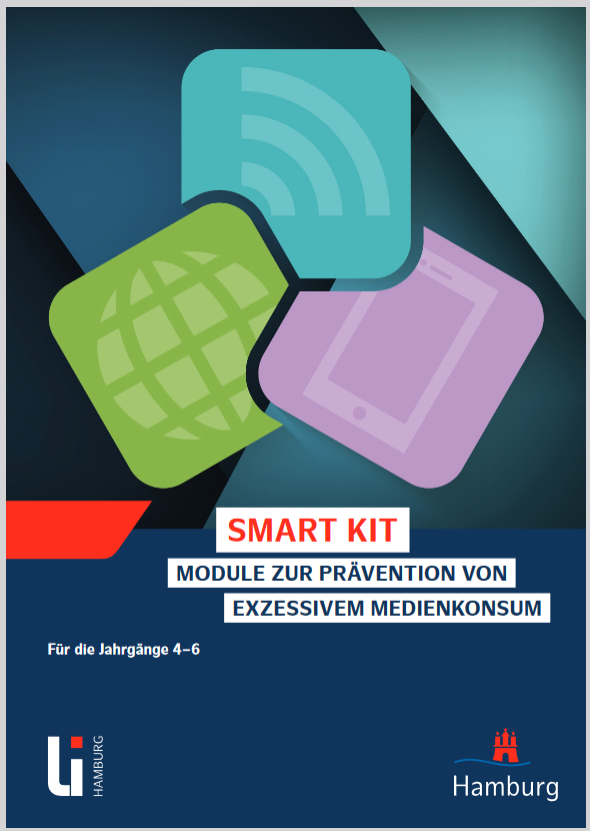Wie viel Bildschirmzeit ist für Kinder angemessen?

Neue Leitlinie, unter Beteiligung der Uni Witten/Herdecke
Mit konkreten Tipps wollen Fachleute helfen, die Bildschirmzeit von Kindern zu begrenzen. Für Kinder und Jugendliche sei es umso besser, je weniger Zeit sie vor Bildschirmen verbringen, heißt es in einer Leitlinie die unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und mit Beteiligung der Uni Witten/Herdecke entstanden ist. Darin geht es darum, einer Suchtentwicklung vorzubeugen.
Die empfohlene gesamte Bildschirmzeit vom Fernsehen über das Spielen am Computer bis zur Internetnutzung per Smartphone:
- Unter 3 Jahren: Die Allerkleinsten sollten von jeglicher passiven und aktiven Nutzung von Bildschirmmedien ferngehalten werden, wie die Autoren schreiben. Das bedeutet, dass vor ihren Augen zum Beispiel möglichst auch die Eltern nicht ständig aufs Handy schauen sollten.
- 3 bis 6 Jahre: Geraten wird zu höchstens 30 Minuten an einzelnen Tagen zum Heranführen an solche Medien. Lassen Sie das Kind dabei nicht allein. Die Nutzung einer Sand- oder Stoppuhr könne helfen zu begreifen, wie schnell die Zeit vor dem Bildschirm verfliegt.
- 6 bis 9 Jahre: höchstens 30 bis 45 Minuten an einzelnen Tagen, außerhalb der Hausaufgaben am Bildschirm.
- 9 bis 12 Jahre: höchstens 45 bis 60 Minuten in der Freizeit vor einem Bildschirm und nur beaufsichtigter Internetzugang.
- 12 bis 16 Jahre: maximal ein bis zwei Stunden täglich in der Freizeit und spätestens bis 21.00 Uhr. Weiterhin mit inhaltlicher Begleitung und beschränktem Internetzugang.
- 16 bis 18 Jahre: Die Zeit durch Regeln festlegen, als ein Orientierungswert werden zwei Stunden Nutzung in der Freizeit pro Tag angegeben.
Insgesamt umfasst die Leitlinie 55 verhaltenspräventive Empfehlungen zur Nutzung von Bildschirmmedien. Darüber hinaus beschreibt sie Möglichkeiten, wie Eltern und Ärzt:innen mit übermäßiger Nutzung umgehen können, und geht auf präventive Maßnahmen in Zeiten von digitalem Fernunterricht ein.
Prävention leistet einen wichtigen Beitrag für eine gesunde Entwicklung des Kindes
„Obwohl inzwischen viele gesundheitliche Risiken des übermäßigen Medienkonsums bei Kindern bekannt sind, wird noch viel zu wenig über Präventionsmaßnahmen gesprochen – sowohl in der Gesellschaft als auch in der Medizin“, sagt Prof. Dr. David Martin, Inhaber des Lehrstuhls für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin an der UW/H. „Wenn wir einem übermäßigen Medienkonsum in Kindheit und Jugend vorbeugen, können wir einen wichtigen Beitrag für eine gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung leisten.“
Erarbeitet wurde die Handreichung unter der Leitung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. Die Universität Witten/Herdecke hat dazu eine Expert:innenkommission gebildet und koordiniert.
Die Leitlinie AWMF S2k richtet sich an Familien sowie an Mediziner:innen, Ärzt:innen und Psychiater:innen, die Kinder und Jugendliche behandeln. Zudem soll sie übergeordneten Organisationen wie Krankenkassen, Schulen, Kindergärten, Jugend-, Schul- und Versorgungsämtern, Erziehungsberatungsstellen oder anderen Personen und Einrichtungen, die sich mit Fragen zu Kindergesundheit und Kindeswohl auseinandersetzen, Orientierung geben. Neben der Langversion für das Fachpublikum fasst eine Kurzversion die wichtigsten Punkte für Erziehungsberechtigte zusammen. Beide Versionen stehen auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) zur Verfügung:
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/027-075
Bis drei: Bildschirmfrei!
Hier können Sie die Kurzversion direkt downloaden
Keine kausalen Zusammenhänge
Die Rechtfertigung jener, die die Warnun der Mediziner:innen in den Wind schlagen und selbst Kleinkinder vor den Bildschirm bringen wollen, besteht zumeist darin, dass der Wirkungszusammenhang zwischen Bildschirmnutzung und psychischer wie physischer Schädigungen nicht eindeutig nachgewiesen wurde.
Das ist zwar einerseits richtig, andererseits ist ein solcher ist ein Versuchsaufbau, der einen kausalen Zusammenhang nachweist auch nicht möglich. Dies würde letztlich bedeuten eine repräsentative Gruppe von Säuglingen aus ihrer normalen Umgebung zu reißen, in zwei Gruppen aufzuteilen und die einen über Jahre hinweg von Bildschirmen auszusetzen, während die anderen dem vermeintlich schädigenden Einfluss ausgesetzt werden.
Insofern trägt die Forderung nach der Herstellung von kausalen Zusammenhängen auch etwas zutiefst Menschenverachtendes in sich. Wem die zahlreichen Studien, die auf die schwere Gesundheitsschädigung von Kindern hinweisen, nicht ausreicht, der sei in seinem Bestreben, Kinder und vor allem Kleinkinder vor den Bildschirm zu setzen mit dem Argument gebremst, dass doch alles zu seiner Zeit stattfinden sollte.
Etwas mehr Entspannung bitte!
Die Vehemenz und Verbissenheit, mit der so manche und so mancher darauf pocht, dass schon Kleinkinder im Krippenalter mit Bildschirmen konfrontiert werden sollten, ist völlig unangebracht. Einerseits ist das Risiko für eine gesundheitliche Schädigung der Kinder hoch, andererseits verpassen sie nichts. Denn schließlich bieten die Empfehlungen der Ärzteschaft genügend Raum dafür, wenn die Kinder etwas älter sind. Wer dagegen eine latente Körperverletzung von Schutzbefohlenen in Kauf nehmen will, dem seien die Worte von Prof. Norbert Neuß in Erinnerung gerufen, der vor einiger Zeit im Interview mit dem Kindergartenträger Fröbel erklärt hat, dass er von Schwarzmalerei und Dämonisierung der Medien zwar nichts halte. Die berechtigte Skepsis und pädagogische Sorge der Kritiker jedoch ernst zu nehmen ist. Schließlich war es der Namensgeber des Unternehmens, Friedrich Wilhelm Fröbel der bei der Gründung des ersten Kindergartens vor rund 180 Jahren auch den Zusammenhang von spielen und lernen erkannte. Der tatsächliche Nachweis konnte allerdings erst vor 25 Jahren mit den bildgebenden Verfahren der Hirnforschung geliefert werden.
Wer also lieber 150 Jahre auf neue Möglichkeiten der Wissenschaft warten möchte, kausale Zusammenhänge herzustellen, um dann festzustellen, dass sein Verhalten den Kindern wohl eher geschadet als genutzt hat, sollte vielleicht schon heute seine Verhaltens- und Denkweise dringend hinterfragen. Niemand verpasst etwas, wenn die Kinder erst ab einem Alter von drei Jahren die ersten vorsichtigen Schritte in die Welt der digitalen Medien machen.
Quelle: Pressemitteilung Universität Witten/Herdecke (UW/H), Mitteilung: Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.
Unsere Artikel von 2021 zum Thema