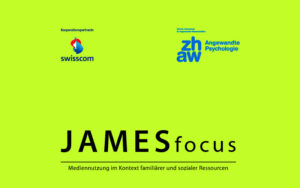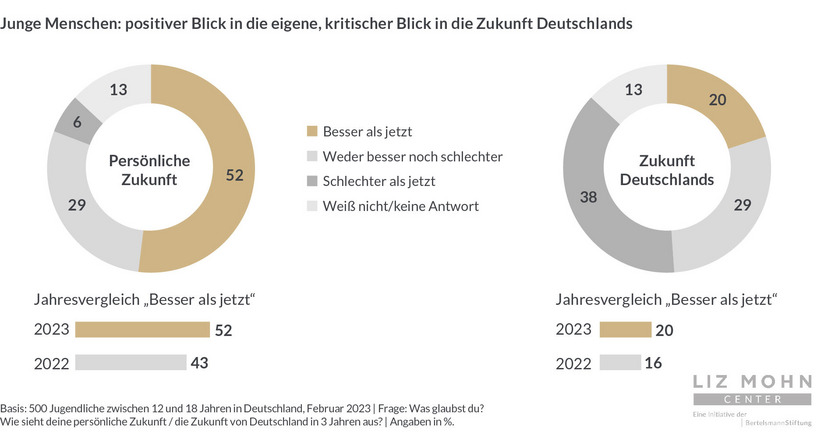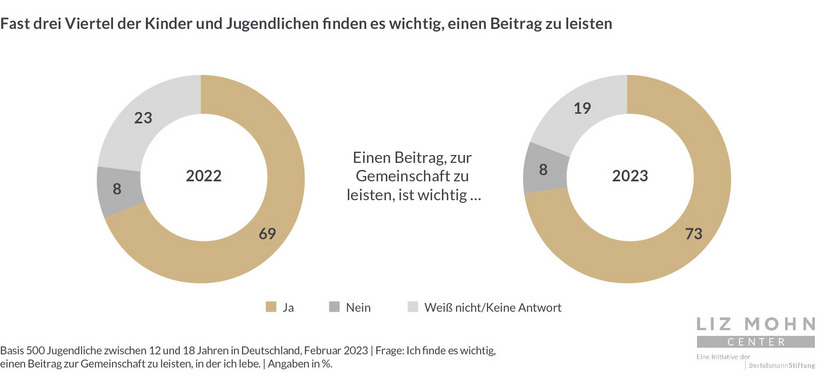Öko-Test: Welche Windeln sind die besten?

Im Test: 15 Wegwerf-Windeln der Größe 4/Maxi
Windeln sollten nicht nur trocken halten, sondern auch frei von Schadstoffen sein. Babylove und Hipp überzeugen mit einem „sehr guten“ Gesamturteil. Kritikpunkt beim Produkt der Marke Pampers: der Einsatz einer erdölbasierten Lotion. Diese meistgekaufte Windelgröße passt Kindern im Alter von einem bis drei Jahren. 90 Prozent der Windelnutzerinnen und -nutzer verwenden laut einer Schätzung des Umweltbundesamtes Wegwerfwindeln. Die Produkte durchliefen umfangreiche Labor- und Praxisprüfungen. In den ersten Lebensmonaten brauchen Babys im Schnitt sieben bis zwölf Windeln am Tag, später dann noch vier bis fünf.
Wie schlagen sich Pampers & Co.?
In Sachen Schadstoffe ist am Material wenig auszusetzen. Kritik gibt es aber für Windeln, die mit einer paraffinbasierten Lotion getränkt sind. Erdölbasierte Substanzen fügen sich schlecht ins Hautgleichgewicht ein.
Windeln im Praxistest
In der Praxisprüfung analysierten Laborexperten, wie gut die Windeln im Test Feuchtigkeit aufsaugen und binden, außerdem überprüften 30 Eltern mit ihren Kindern die Alltagstauglichkeit der Produkte. Im Paneltest der Familien ging es um Handhabung, Feuchtigkeitsrückhalt, Tragekomfort und Weichheit der Windeln. Was ist aufgefallen?
Umweltprobleme bei Wegwerfwindeln: Optische Aufheller und Kunststoffverpackungen
In neun Windelmarken hat das Labor optische Aufheller nachgewiesen. Diesw können nur schwer abgebaut werden und belasten die Umwelt. In den Vergaberichtlinien des Blauen Engel wird diese Anwendung als Ausnahme genannt, obwohl der bewusste Einsatz optischer Aufheller sonst explizit verboten ist. Auch Produkte mit dem EU Ecolabel dürfen keine absichtlich eingesetzten optischen Aufheller enthalten. Hier ergibt sich jedoch aus der Begriffsdefinition ebenfalls ein Schlupfloch für den Einsatz zur Qualitätssicherung bei der Produktion.
Einige Windeln im Test mit Recyclinganteil.
Nur ein überprüftes Produkt ist in umweltfreundlichem Papier verpackt. Die anderen Windelhersteller setzen auf Umverpackungen aus Kunststoff, von denen aber einige zumindest einen Recyclinganteil enthalten.
Drei Marken mit Öko-Aufmachung wurden in den Test aufgenommen.
Eco by Naty fällt mit dem großspurigen Claim „Plastic sucks“ auf und gibt an, auf pflanzenbasierten Kunststoff zu setzen – laut Verpackung bestehen jedoch nicht wenige Elemente der Windel aus herkömmlichem Plastik.
Moltex und Blütezeit tragen immerhin das EU Ecolabel, das besondere Anforderungen an die Schadstofffreiheit und Umweltverträglichkeit der Produkte stellt – etwa dass der eingesetzte Zellstoff nachweislich in nachhaltiger Forstwirtschaft erzeugt und nur chlorfrei gebleicht wurde; Baumwolle muss aus biologischer Landwirtschaft stammen. Zudem beinhalten die Vergabekriterien Vorgaben zu den CO2-Emissionen und dem Ressourcenverbrauch während der Produktion. Das EU Ecolabel wurde 1992 von der EU-Kommission eingeführt. Windelhersteller, die dieses Gütesiegel für ihre Produkte nutzen wollen, müssen regelmäßig im Zuge unabhängiger Überprüfungen nachweisen, dass sie die Kriterien erfüllen.
Vergleichbare Anforderungen stellt auch der Blaue Engel
der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Dessen Kriterien werden wissenschaftlich vom Umweltbundesamt erarbeitet und vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung RAL zertifiziert. In dem Test tragen es die Windelmarken Babydream, Beauty Baby, Elkos und Hipp, allesamt ohne Öko-Auslobung.
Den Einsatz von Kunststoff schließen aber weder der Blaue Engel noch das EU Ecolabel grundsätzlich aus.
Weitere Informationen und die Testergebnisse finden Sie auf oekotest.de