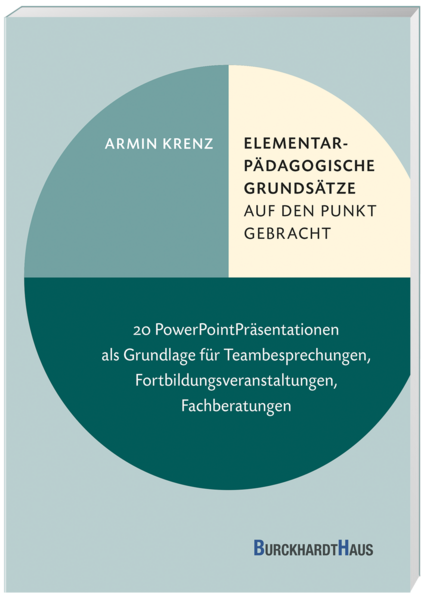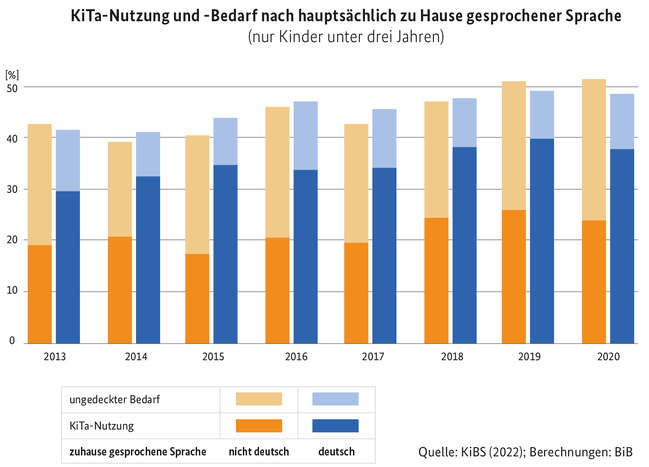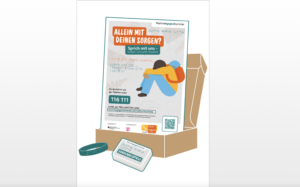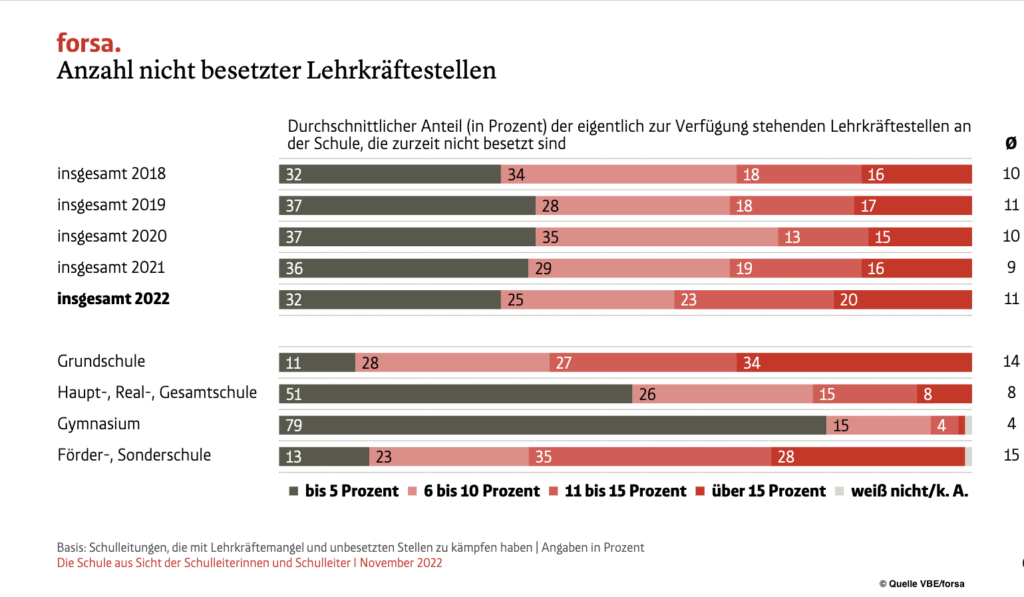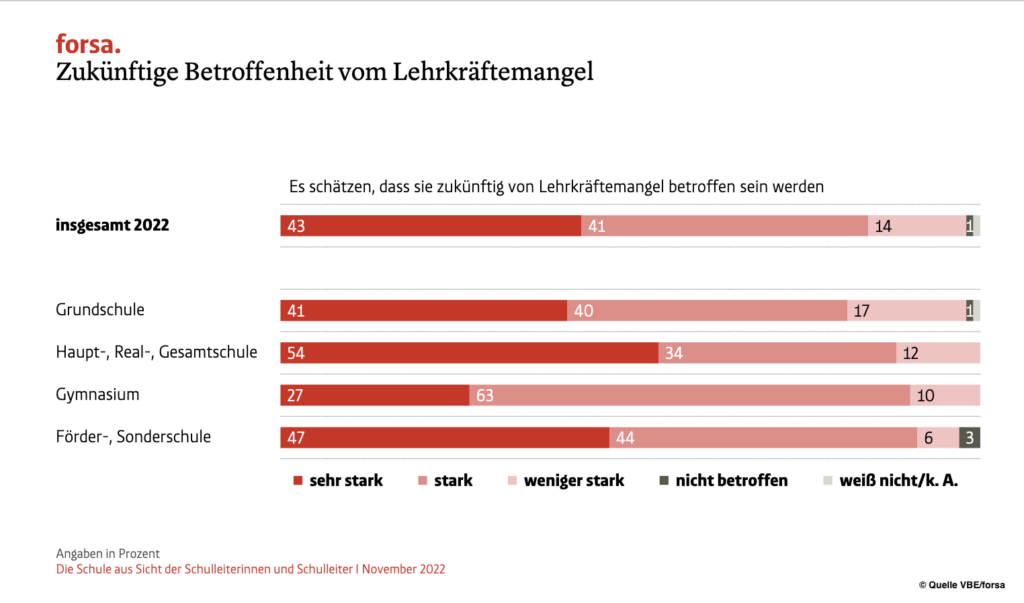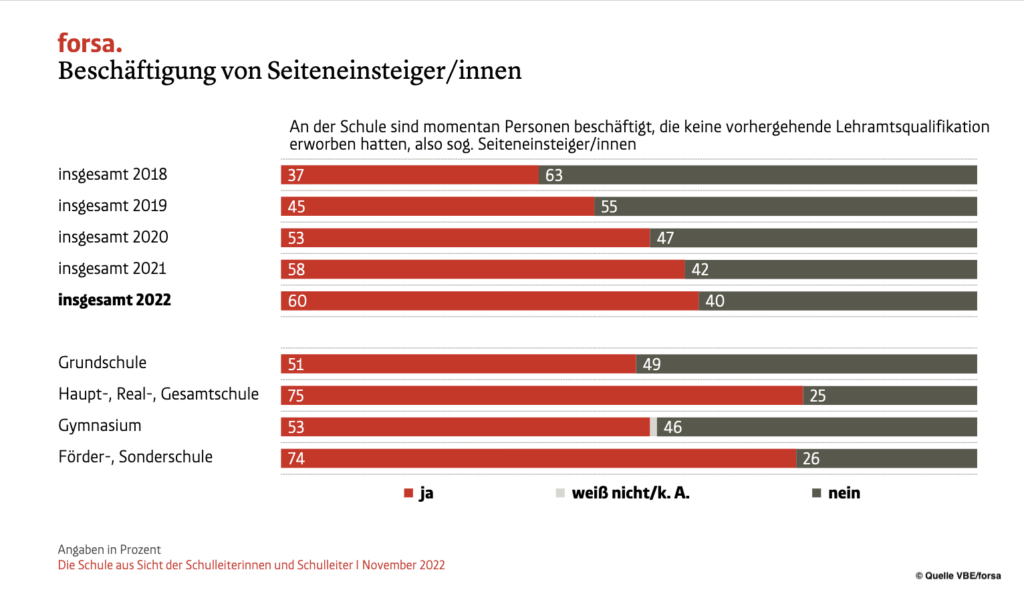DAK-Studie: In der Pandemie hat sich die Mediensucht verdoppelt

Über 600.000 Jungen und Mädchen zeigen ein pathologisches Nutzungsverhalten
In der Pandemie hat sich laut einer Studie der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) zufolge die Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen verdoppelt. Inzwischen wären demnach mehr als sechs Prozent der Minderjährigen abhängig von Computerspielen und sozialen Medien. Damit würden über 600.000 Jungen und Mädchen ein pathologisches Nutzungsverhalten zeigen. Auch die Medien-Nutzungszeiten sind seit 2019 um ein Drittel gestiegen.
Das zeigt eine aktuelle gemeinsame Längsschnittstudie der DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Der Vergleich der digitalen Mediennutzung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern in bundesweit 1.200 Familien an fünf Messzeitpunkten der vergangenen vier Jahre gilt als weltweit einzigartig. Erstmals wurde jetzt auch das Suchtpotential beim Streaming und körperliche Probleme untersucht. DAK-Vorstandschef Andreas Storm und Mediziner sehen eine alarmierende Entwicklung und fordern mehr Prävention und Hilfsangebote für die Betroffenen.
Nach der aktuellen Studie von DAK-Gesundheit und UKE Hamburg stieg die Zahl abhängiger Kinder und Jugendlicher bei Computerspielen von 2,7 Prozent im Jahr 2019 auf 6,3 Prozent im Juni 2022. Hochgerechnet haben damit rund 330.000 Jungen und Mädchen nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine krankhafte Gaming-Nutzung mit schweren sozialen Folgen. Die aktuellen Ergebnisse Längsschnittstudie zeigen: Rund 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche nutzen Gaming, Social Media oder Streaming problematisch, das heißt sie sind von einer Sucht gefährdet oder bereits betroffen. Im Bereich Social Media verdoppelte sich die Mediensucht von 3,2 auf 6,7 Prozent mit rund 350.000 Betroffenen. Laut Studie zeigen rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche eine problematische Nutzung bei Computerspielen und oder sozialen Medien.
DAK-Chef Storm: Die Zukunft vieler junger Menschen ist bedroht
„Die aktuellen Zahlen und die Entwicklung in der Pandemie sind alarmierend“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit. „Wenn jetzt nicht schnell gehandelt wird, rutschen immer Kinder und Jugendliche in die Mediensucht und der negative Trend kann nicht mehr gestoppt werden. So würden Familien zerstört und die Zukunft vieler junger Menschen bedroht.“ Als Reaktion müssten Prävention und Hilfsangebote ausgebaut werden und neue Akzente in der Bildungs- und Familienpolitik gesetzt werden. „Es ist eine neue Entwicklungsaufgabe von Politik und Gesellschaft, dass Kinder und Jugendliche lernen, die Risiken der Nutzung digitaler Medien einschätzen zu können und ihr Nutzungsverhalten zu reflektieren, damit sie die Möglichkeiten der digitalen Welt langfristig für ihr privates und berufliches Leben konstruktiv nutzen können.“ Ein richtiger Ansatz sei der Einsatz von Mental Health Coaches in Schulen, wie er von Bundesfamilienministerin Lisa Paus geplant sei.
Nutzungszeiten über Vor-Pandemie-Niveau
Laut Studie von DAK-Gesundheit und UKE-Hamburg sind Nutzungszeiten von Computerspielen und Social Media weiter angestiegen. Nach einer starken Zunahme im ersten Corona-Lockdown im April 2020 gab es zunächst einen Rückgang. Diese positive Entwicklung setzte sich jedoch nicht fort: Im Juni 2022 lagen die Nutzungszeiten beim Gaming mit 115 Minuten an Werktagen knapp 34 Prozent höher als im September 2019 vor der Pandemie. Einen ebenso deutlichen Anstieg gab es im gleichen Zeitraum bei den sozialen Medien mit 35,5 Prozent von 121 Minuten auf 164 Minuten täglich.
Körperliche Beschwerden durch exzessive Mediennutzung
Erstmals untersuchte die Studie auch die körperlichen Auswirkungen exzessiver Mediennutzung. Das Ergebnis: Ein Drittel der Befragten klagt nach mehrstündiger Nutzung von digitalen Geräten über Nackenschmerzen (32,1 Prozent). 23,4 Prozent haben trockene oder juckende Augen, 16,9 Prozent gaben an, Schmerzen im Unterarm oder der Hand zu haben.
Rückgang bei Streamingzeiten
Seit November 2020 untersucht die Studie auch das Streamingverhalten von Kindern und Jugendlichen. Hier zeigte sich einen Rückgang im Vergleich zum vorherigen Messzeitpunkt: Im Juni 2022 streamten die Befragten an einem durchschnittlichen Werktag 107 Minuten Videos und Serien. Die Zahlen liegen damit auf einem ähnlichen Niveau wie 2020 (104 Minuten) und deutlich niedriger als 2021 (170 Minuten). Insgesamt nutzten rund 733.000 Kinder und Jugendliche Streaming riskant, 2,4 Prozent zeigen ein pathologisches Nutzungsverhalten. Das entspricht rund 126.000 Betroffenen.
Große Schnittmengen bei problematischer Nutzung
Das Ausmaß der Gesamtproblematik wird insbesondere bei der Betrachtung der Schnittmengen deutlich: 5,1 Prozent aller Befragten zeigen eine problematische Nutzung von Gaming und Social Media, was rund 270.000 Betroffenen entspricht. 1,1 Prozent nutzt darüber hinaus auch Streaming-Angebote problematisch – 58.000 Kinder und Jugendliche wären damit von diesem riskanten Dreiklang betroffen.
Prof. Thomasius: Mediennutzung gegen Einsamkeit und Stress
„Die Ergebnisse unserer Studie machen erneut deutlich, dass die andauernde Covid-19-Pandemie unseren Umgang mit digitalen Medien nachhaltig verändert hat und dass insbesondere Kinder und Jugendliche unter den Einschränkungen litten“, sagt Prof. Dr. Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter am Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) im UKE. „Trotz zunehmender Lockerungen der Corona-Verordnungen bleiben digitale Medien weiterhin ein wichtiger Bestandteil in der Aufrechterhaltung von Kontakten, der Bekämpfung von Langeweile oder der Beschaffung von Informationen. Sie können bei manchen aber auch dazu dienen, Gefühle von Einsamkeit, sozialer Isolation und Kontrollverlust, aber auch Stress und andere negative Gefühle zu kompensieren. Diese Nutzerinnen und Nutzer sind besonders gefährdet, eine Sucht zu entwickeln.“ Nach Einschätzung des Suchtexperten Thomasius führt eine exzessive Mediennutzung oft zu Kontrollverlust mit weitreichenden Folgen. „Da persönliche, familiäre und schulische Ziele in den Hintergrund treten, werden alterstypische Entwicklungsaufgaben nicht angemessen gelöst“, erklärt er. „Ein Stillstand in der psychosozialen Reifung ist die Folge. Die Ergebnisse unserer Studie machen einmal mehr deutlich, wie wichtig Präventions- und Therapieangebote für Kinder und Eltern sind.“
Jungen häufiger von Sucht betroffen
Insgesamt sind Jungen häufiger suchtgefährdet oder bereits von einer Sucht betroffen als Mädchen – insbesondere beim Gaming. So zeigen 18,1 Prozent der Kinder und Jugendlichen eine problematische Nutzung digitaler Spiele. Davon sind 68,4 Prozent Jungen. Bei den sozialen Medien, die 23,1 Prozent aller Befragten problematisch nutzen, ist die Verteilung mit 52,1 Prozent (Jungen) bzw. 47,9 Prozent (Mädchen) hingegen etwas ausgewogener. Im Hinblick auf die Altersstruktur zeigt sich, dass besonders ältere Jugendliche deutlich häufiger eine Abhängigkeit von digitalen Medien zeigen.
„Auch nach der Corona-Pandemie ist eine riskante Mediennutzung bei vielen Kindern und Jugendlichen Alltag“, sagt Dr. Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ). „Jetzt ist es wichtiger denn je, die Prävention zu stärken, allen voran im schulischen Bereich. Ebenso wichtig ist aber auch die Früherkennung von Mediensucht, beispielsweise durch ein Mediensuchtscreening in der Kinder- und Jugendarztpraxis.“
Weltweit einzigartige Untersuchung
Die repräsentative DAK-Längsschnittstudie zur Mediennutzung im Verlauf der Corona-Pandemie untersucht die Häufigkeiten pathologischer und riskanter Nutzung von Spielen, sozialen Medien und Streamingdiensten bei Kindern und Jugendlichen basierend auf den neuen ICD-11-Kriterien der WHO. Bundesweit wurden rund 1.200 Familien nach ihrem Medienverhalten befragt. Die DAK-Gesundheit führt dazu gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in mehreren Wellen Befragungen durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa durch. Dafür wird eine repräsentative Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren mit je einem Elternteil zu ihrem Umgang mit digitalen Medien an bisher fünf Messzeitpunkten befragt. Nach den Befragungen im September 2019, im April 2020, im November 2020 und im Mai 2021 spiegeln die aktuellen Erkenntnisse die Ergebnisse der jüngsten Befragung im Juni 2022 wider. Die Studie, die Zusammenhänge zwischen Nutzungsmustern, Nutzungsmotiven und familiären Nutzungsregeln über den Verlauf der Pandemie hinweg untersucht, ist weltweit einmalig.
Hotline und Online-Anlaufstelle
Für Kinder und Jugendliche, die ein problematisches Mediennutzungsverhalten haben, sowie für deren Eltern hat die DAK-Gesundheit gemeinsam mit dem DZSKJ eine Online-Anlaufstelle Mediensucht entwickelt: Auf www.mediensuchthilfe.info erhalten Betroffene und deren Angehörige Informationen und Hilfestellungen rund um die Themen Gaming-, Social-Media- und Streaming-Sucht. Am Mittwoch, den 29. März, stellt das DZSKJ darüber hinaus eine Hotline für betroffene Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige bereit. Unter der Telefonnummer 0800 2 800 200 geben Suchtexpertinnen und -experten des UKE von 9 bis 16 Uhr Antworten auf Fragen rund um das Thema Mediensucht. Das Serviceangebot ist kostenlos und steht Versicherten aller Kassen offen.
Quelle: Pressemitteilung, DAK