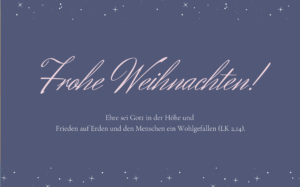Zukunft sichern und Kinderrechte stärken

Deutsches Kinderhilfswerk zum Jahrensauftakt
Das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) appelliert zum Jahresbeginn an Bund, Länder und Kommunen, in diesem Jahr die Kinderrechte endlich umfassend zu einer Leitlinie von Politik, Rechtsprechung und Verwaltungshandeln zu machen. „Derzeit brennt es an allen Ecken und Enden. In den Kitas, in den Schulen, bei der Versorgung von Kindern in Krankenhäusern und mit Medikamenten. Das alles ist das Ergebnis einer Politik, die Kinderinteressen über Jahre systematisch ausgeblendet hat und es vielfach noch immer tut. Deshalb gehören die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen endlich als ein vorrangiger Gesichtspunkt ins Zentrum politischen Handelns. Dafür braucht es zuvorderst eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, eine aktive Politik zur Überwindung der Kinderarmut in Deutschland sowie eine deutliche Stärkung der demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen. Wirksame Maßnahmen für ein kinderfreundliches Deutschland gehören auf der politischen Agenda ganz nach oben, nicht allein im besten Interesse der Kinder und Jugendlichen selbst, sondern letztlich für nichts weniger als die Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer gesamten Gesellschaft. Obwohl Kinderfreundlichkeit in Sonntagsreden immer wieder beschworen wird, kommt der Kinder- und Jugendpolitik nach wie vor nicht der Stellenwert zu, den dieses Zukunftsthema verdient“, betont Thomas Krüger, Präsident des DKHW.
Kinderrechte ins Grundgesetz
Der Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz kommt aus Sicht des DKHW besondere Bedeutung zu. „Deshalb brauchen wir zügig einen neuen Anlauf zur verfassungsmäßigen Verankerung der Kinderrechte, um eine nachhaltige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention sicherzustellen. Dabei müssen die Kinderrechte auf Förderung, Schutz und Beteiligung sowie der Kindeswohlvorrang Grundlage der Normierung sein. Es braucht im Grundgesetz einen eigenen Artikel für die Kinderrechte, die unabhängig von den Elternrechten und ohne mit ihnen in Konflikt zu geraten gegenüber dem Staat gelten. Kinderrechte im Grundgesetz könnten sich mit eindeutigen Formulierungen für Kinder und Jugendliche positiv bei der Planung und Gestaltung in allen Politikfeldern auswirken und auch zu einem Umdenken in der Verwaltung führen“, so Krüger weiter.
Das DKHW fordert die Bundesregierung nachdrücklich dazu auf, neben der Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz weitere wirksame Maßnahmen für ein kinderfreundliches Deutschland auf den Weg zu bringen. „Wir müssen endlich das strukturelle Problem der Kinderarmut nachhaltig beseitigen. Viele Familien trifft die Inflation und die Energiekrise mit beispielloser Wucht. Sie geraten über die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten, sind finanziell schlicht am Ende. Wir brauchen deshalb schnellstmöglich eine Kindergrundsicherung, die ihren Namen verdient. Gerade Familien mit wenig Einkommen kann die Kindergrundsicherung dazu verhelfen ihre Kinder zu versorgen, ohne auf weitergehende staatliche Unterstützung angewiesen zu sein. Bis zu ihrer Einführung muss es deutlichere Aufschläge auf die Transfersysteme geben als bisher geplant“, so Krüger weiter.
Beteiligung von Kinder sollte selbstverständlich sein
„Zudem sollte die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden Entscheidungen endlich zu einer Selbstverständlichkeit werden. Verbindliche Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen müssen systematisch ausgebaut und strukturell verankert werden, zuvorderst im Grundgesetz. Kinder und Jugendliche werden durch frühe Beteiligungserfahrungen in ihren sozialen Kompetenzen gefördert, gleichzeitig leistet frühe Beteiligung von Kindern einen fundamentalen Beitrag zur langfristigen Stärkung unserer Demokratie. Hier kann das geplante Demokratiefördergesetz eine gute Grundlage bilden. Kinder dürfen nicht als eine Altersgruppe begriffen werden, die auf demokratische Mitwirkung im Erwachsenenalter vorbereitet wird, sondern die bereits als Kinder konstitutiver Teil der gesamtgesellschaftlichen demokratischen Praxis sind. Daher ist es im Feld der Demokratiearbeit unverzichtbar, demokratische Kompetenzen sowie ein Miteinander zu fördern, in dem Vielfalt wertgeschätzt wird sowie alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, dieses aktiv mitzugestalten“, sagt Thomas Krüger.
Quelle: Pressemitteilung DKHW