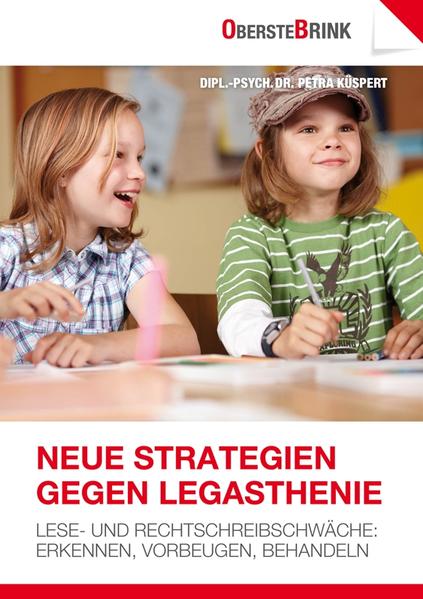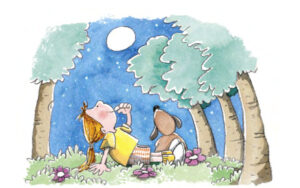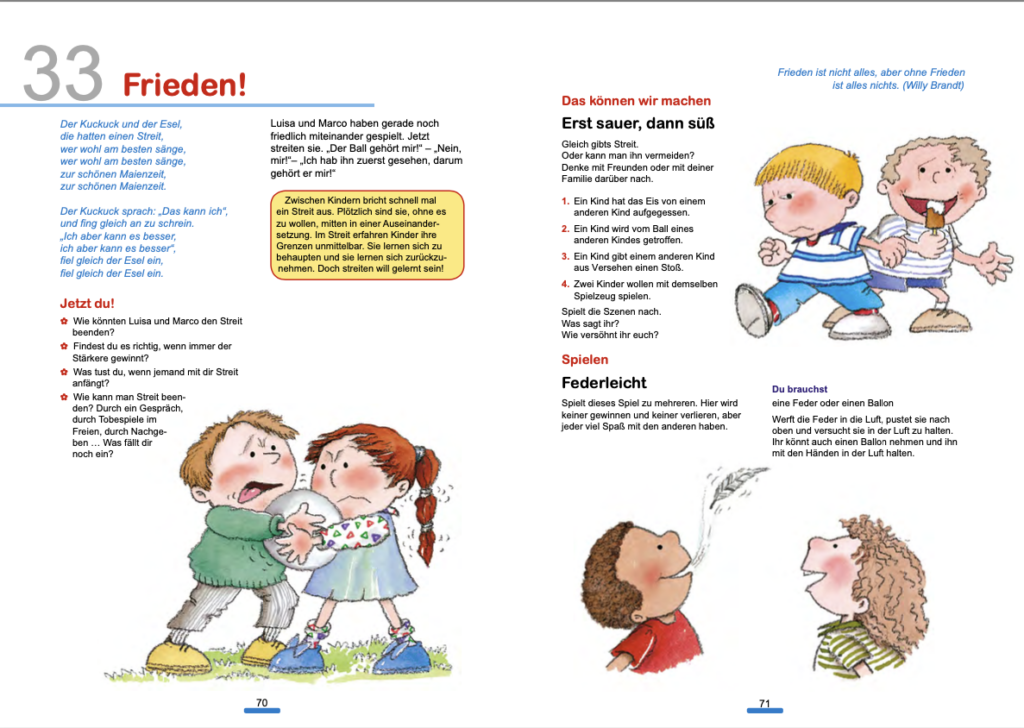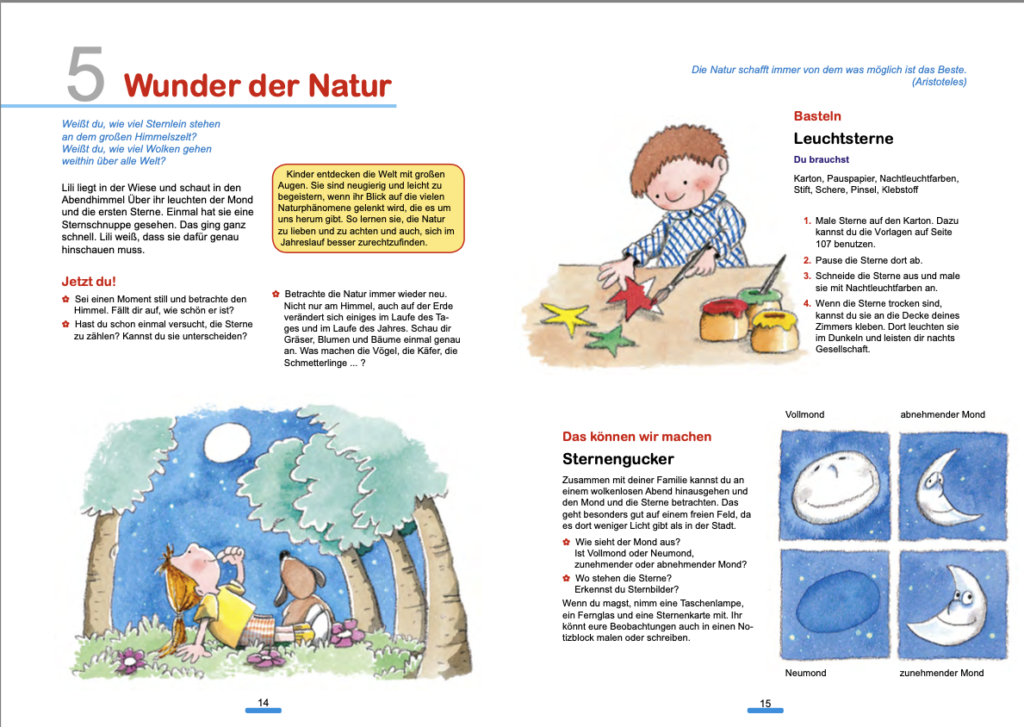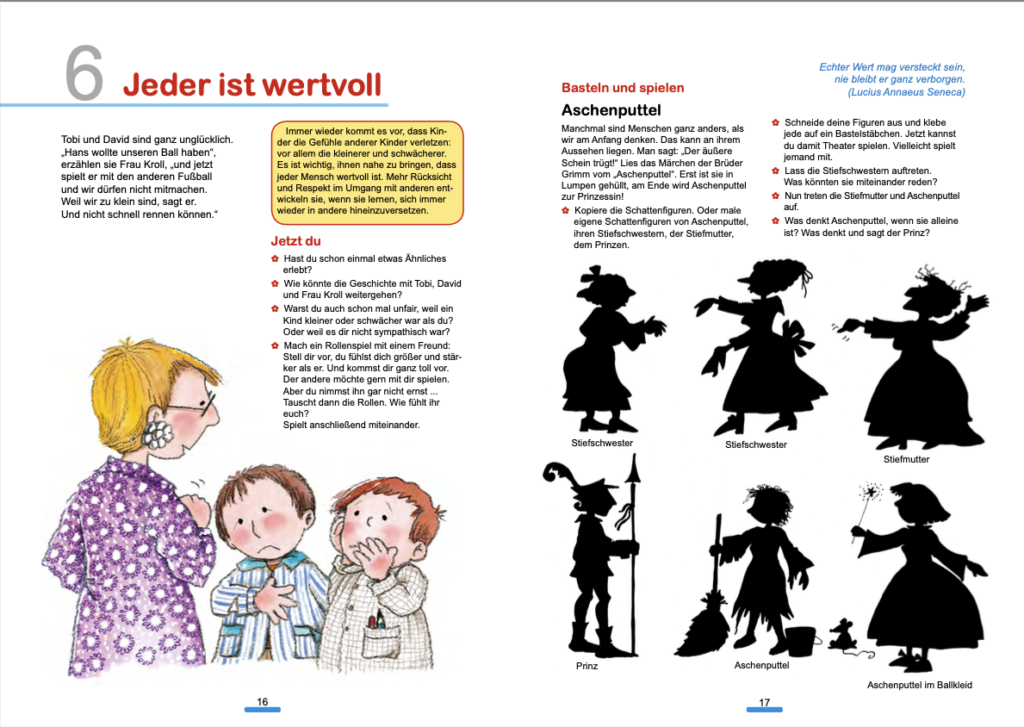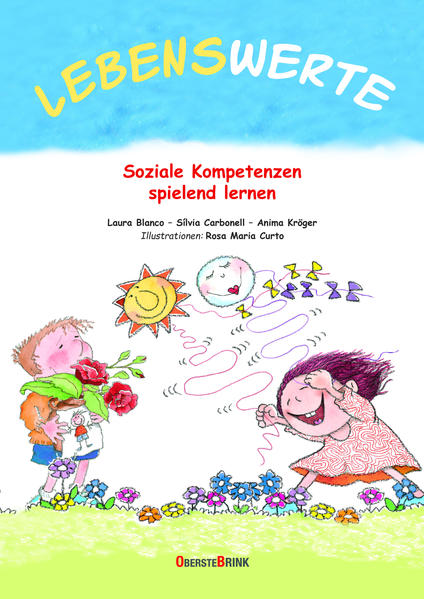Wissenschaftler untersuchen Entwicklung in der Grundschulzeit
Die Fähigkeit, sich auf andere einzustellen, wächst von Geburt an. Hartmut Rosa und Joachim Bauer untersuchen seit Jahren das Phänomen der Resonanz, mit deren Hilfe schon das Neugeborene in Interaktion geht. Mit der Ich-Erkenntnis im zweiten Lebensjahr wächst die Fähigkeit andere einzuschätzen. Eben ist eine Studie erschienen, die diese Entwicklung in der Grundschulzeit erforscht hat. Aus dieser sollen sich nun besondere Anforderungen an die Schulen und das Elternhaus ableiten lassen. Denn manches unterstützt diese Entwicklung, anderes hemmt sie.
Über eine lebenswichtige Fähigkeit
Als der Mensch noch nicht an der Spitze der Nahrungskette stand, war seine Fähigkeit, seine Umgebung einzuschätzen, überlebenswichtig. Gelang ihm das nicht, konnte er relativ leicht in große Not geraten. Erschlagen oder gefressen zu werden gehörte damals zum Alltag.
Die Anlagen zur Einschätzung seiner Umwelt und seiner Mitmenschen sind schon in seinen Genen angelegt. Und wenn wir ihn dabei nicht allzu sehr stören würden, könnte er diese auch gut entwickeln. Der Arzt und Psychiater Joachim Bauer beschreibt in seinem „Wie wir werden, wer wir sind“, wie es Kindern in den ersten Lebensjahren gelingt, ein Ich, Du oder Wir zu denken, zu fühlen, zu erleben? Die Resonanz, vornehmlich die Interaktion zwischen Säugling und vor allem der Mutter, bildet den Anfang. Darüber entsteht auch die Spielfähigkeit, wie sie etwa Armin Krenz beschreibt. Und über das freie Spiel und die verschiedenen Interaktionsspiele lernen Kinder sich und den anderen einzuschätzen.
Komplexere Fähigkeiten in der Grundschulzeit
Komplexere Fähigkeiten im Verständnis anderer entwickeln sich laut einer Studie von Christopher Osterhaus, Juniorprofessor für Entwicklungspsychologie im Handlungsfeld Schule in Vechta und Susanne Koerber, Professorin für Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule Freiburg, erst im Laufe der Grundschulzeit. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse bereits in der renommierten Forschungszeitschrift „Child Development“.
Die Studie haben Osterhaus und Koerber an 161 Kindergarten- und Grundschulkindern über einen Zeitraum von fünf Jahren durchgeführt. In dieser Zeithaben sie in relativ kurzen Intervallen eine hohe Anzahl an Test-Aufgaben durchgeführt.
„Wir haben die Kinder zum ersten Mal im Kindergarten interviewt und sie dann bis ans Ende der Grundschulzeit begleitet“, erläutert Osterhaus. „Dabei haben wir jährlich ihre Kompetenzentwicklung gemessen. Auf diese Weise lässt sich sehr genau verfolgen, wann Entwicklungsschritte auftreten und wovon diese abhängen.“
Aufgaben als Verständnistest
Die Kinder bekamen von den Wissenschaftlern dabei Test-Aufgaben. Darunter die Geschichte über ein Mädchen, das eine Überraschungsparty versehentlich ausplaudert. „Knapp 90 Prozent der Neunjährigen erkennen, dass solche Situationen nicht auf Absicht beruhen2, sagt Osterhaus. „Diese Fähigkeit scheint auf einen relativ simplen Prozess zurückzugehen, bei dem Kinder das, was in ihrem sozialen Umfeld passiert, mehr oder minder automatisch wahrnehmen und bewerten. Und je mehr Erfahrung sie hierin haben, desto besser scheint diese Bewertung zu funktionieren.“
Missverständnisse verstehen lernen
Osterhaus und Koerber schließen aufgrund ihrer Forschungsergebnisse darauf, dass Kinder rund um das erste Schuljahr verstehen, dass es zwischen Menschen zu Missverständnissen kommen kann. Darüber hinaus folgern sie, dass diese Einsicht eine wesentliche Grundlage für viele weitere Entwicklungen in der Fähigkeit, andere zu verstehen, ist. Zu den komplexen Fähigkeiten, die sich im Verlauf der Grundschule entwickeln, gehört Sarkasmus zu erkennen, die Gefühle anderer an den Augen abzulesen, sich in die Gedankenwelt eines anderen zu versetzen und einen Fauxpas auszumachen. All dies sind wichtige sozial-kognitive Fähigkeiten, die als „intuitive Psychologie“ beschrieben werden.
Intelligenz und Erfahrung entscheiden über Entwicklung
Andere Fähigkeiten scheinen sich aber nicht in erster Linie durch ein Mehr an Erfahrung zu entwickeln. So hängt das Verständnis davon, dass zwei Leute dieselbe Information anders interpretieren, nicht mit dem Alter zusammen, mit dem einzelne Kinder den grundlegenden Meilenstein im Verständnis anderer erlangen. Nur rund 60% der Neunjährigen lösten eine entsprechende Aufgabe korrekt. Stattdessen hing diese Fähigkeit mit der Intelligenz der Kinder zusammen: Zum Ende der Grundschule schnitten intelligentere Schülerinnen und Schüler bei den entsprechenden Tests besser ab.
Das lässt vermuten, dass sich dieses Verständnis nicht allein mit der Erfahrung entwickelt, wie etwa das Erkennen einer sozialen Regelübertretung. Sondern dass Kinder sich explizit hiermit auseinandersetzen müssen. Sie müssen also lernen, die komplexe Funktionsweise unseres Denkens zu verstehen und zudem eine Theorie darüber entwickeln, nach welchen Mustern komplexe soziale Interaktionen ablaufen.
Psychologische Grundausbildung in Familie und Schule notwendig
Zu Beginn der Grundschulzeit sind laut Studienergebnissen grundlegende Fähigkeiten vorhanden, vieles aber entwickelt sich noch. Lehrkräfte und Eltern müssen also oft Geduld haben, da die Kinder längst nicht alles verstehen. Osterhaus konkretisiert: „Einige Aspekte entwickeln sich aller Wahrscheinlichkeit nach ohne großes Zutun, allein durch Erfahrung. Entscheidend ist also, dass Kinder diese Erfahrung machen können – und das ist ja auch durch Corona aktuell oft nur begrenzt der Fall. Bei anderen Aspekten sollte man hingegen explizit fördern.“
Für Lehrkräfte wie Eltern sei es deshalb wichtig, mit Kindern entsprechende Situationen durchzusprechen, ihnen zu erklären, warum die Beteiligten Bestimmtes denken und es an die Erfahrungswelt der Kinder rückkoppeln. „Auch sollten wir Kindern die passenden Wörter beibringen“, sagt Christopher Osterhaus. „Wenn ein Grundschulkind an der Augenpartie einer Person nicht ablesen kann, dass diese Person durchsetzungsfähig ist, liegt dies wahrscheinlich daran, dass es ‚keinen Begriff‘ von diesem Zustand hat.“
„Wir haben festgestellt, dass Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit viel Potenzial haben zur Entwicklung von sozial-kognitiven Fähigkeiten. Die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Lernziel von Schule. Und gerade bei Konflikten ist es wichtig, dass Kinder über die nötigen Tools verfügen, um sich in andere hineinzuversetzen und Konflikte so effektiv zu lösen. Es gibt gute Trainingsprogramme, die man leicht in der Grundschule implementieren könnte. Gerade jetzt im Verlauf der Corona-Pandemie wäre dies vielleicht ein wertvoller Ansatz.“
Ausblick
An der Universität Vechta laufen in Kooperation mit anderen Hochschulen weitere Studien zum tieferen Verständnis unserer „intuitiven Psychologie“. In einer Zusammenarbeit mit der Brock University (Kanada) führen die Wissenschaftlern Sandra Bosacki und Christopher Osterhaus eine systematische Reviewstudie zur optimalen Erfassung komplexer Fähigkeiten im Verständnis anderer durch.
Auch die Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg wird fortgeführt: Die Wissenschaftlern Koerber und Osterhaus erforschen die Frage, ob es sich bei der Fähigkeit, andere zu verstehen, tatsächlich um eine einzelne Kompetenz handelt, so wie sie bisher betrachtet wird. Bisherige Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich dagegen um ein komplexes Zusammenspiel aus Fähigkeiten handelt. Woraus setzt sich also die Fähigkeit andere zu verstehen zusammen und wann entwickeln sich die einzelnen Bestandteile?