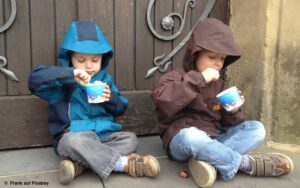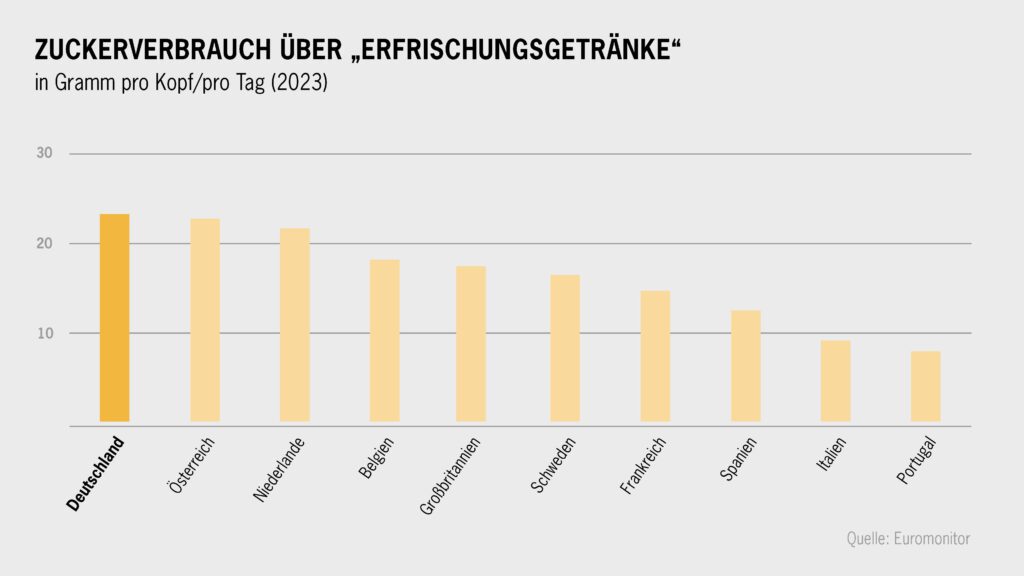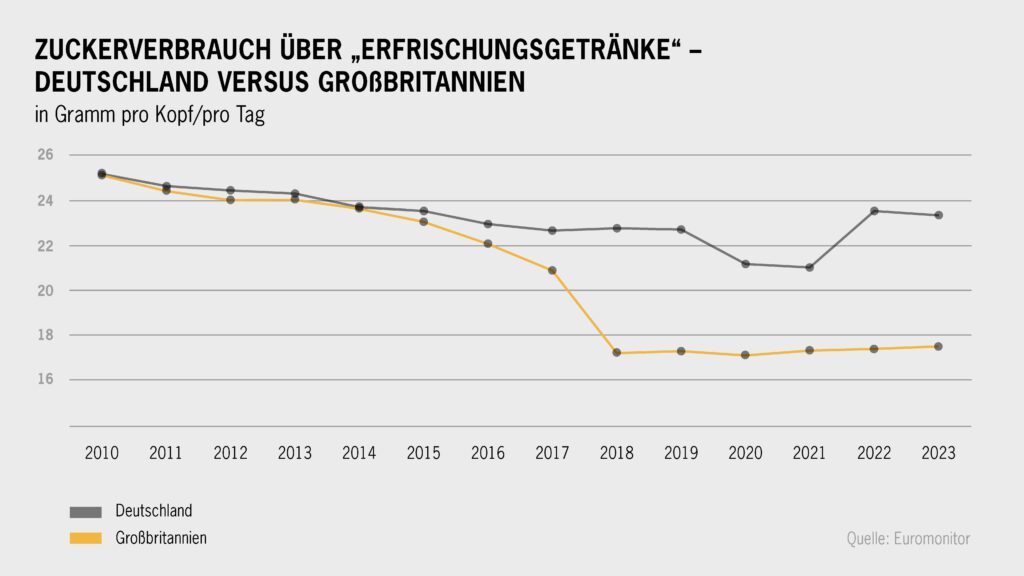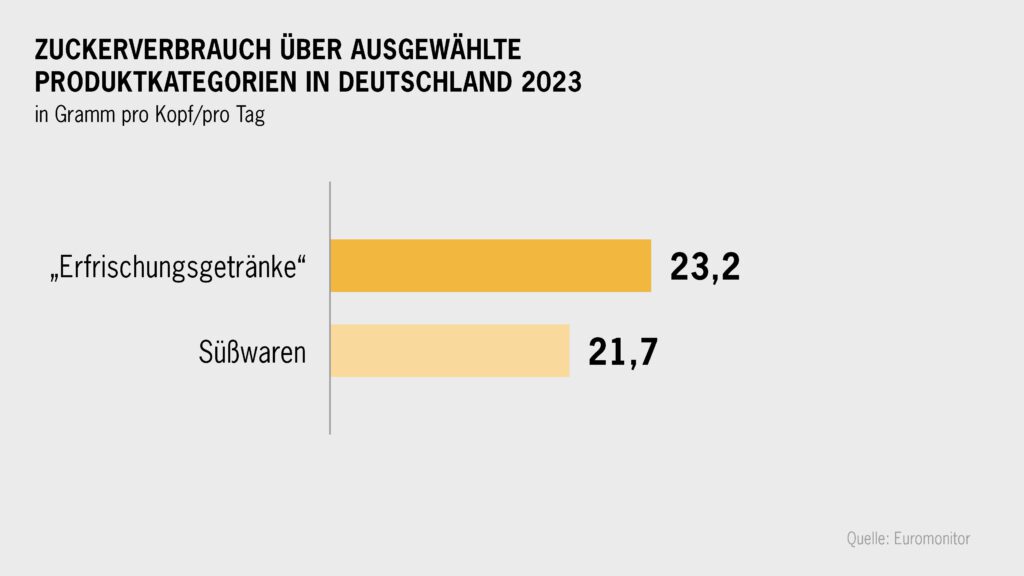Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet den Kurs „Essalltag in Familien gestalten“ an
Die frühe Kindheit prägt unser Essverhalten für das ganze Leben. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Essgewohnheiten in der Familie. Auswahl und Zubereitung von Mahlzeiten sowie das gemeinsame Essen können für Familien mit kleinen Kindern jedoch herausfordernd sein.
Vom Einkauf bis zur Gestaltung des Essalltags
Fachkräften, die Familien mit Babys und Kleinkindern dabei unterstützen, steht jetzt der neue qualitätsgesicherte Online-Kurs „Essalltag in Familien gestalten“ auf der Lernplattform Frühe Hilfen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Verfügung. Er richtet sich an alle Fachkräfte im Umfeld junger Familien und insbesondere an diejenigen in den Frühen Hilfen. Fachkräfte erhalten praxisnahe und leicht umsetzbare Tipps und Methoden, um junge Familien bei Fragen vom Einkauf bis zur Gestaltung des Essalltags begleiten zu können.
Gefördert von der Bundesstiftung Frühe Hilfen
Der kostenfreie Online-Kurs wurde vom NZFH in Zusammenarbeit mit den Referaten Netzwerk Gesund ins Leben und Ernährungsbildung des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) entwickelt. Er ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) entstanden und wurde mit Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen des BMFSFJ gefördert.
Wertvolle Zeit für Gespräche
Ekin Deligöz, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: „Gemeinsames Essen in der Familie ist weit mehr als nur Nahrungsaufnahme – es ist eine wertvolle Zeit für Gespräche und schafft Momente, um Erlebnisse zu teilen. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist es wichtig, solche Rituale zu pflegen, denn sie stärken das familiäre Miteinander und fördern die Bindung innerhalb der Familie. Fachkräfte erfahren durch den Online-Kurs, wie sie Eltern praxisnahe Unterstützung an die Hand geben können, damit gemeinsame Mahlzeiten bewusst gestaltet werden können.“
Familien wollen sich gesund und nachhaltig ernähren
Dr. Ophelia Nick, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft: „Die meisten Familien wollen sich gesund und nachhaltig ernähren. Gerade für Familien in belasteten Lebenslagen kann das jedoch eine Herausforderung sein. Wir wollen gutes Essen für alle leichter machen – gemeinsam mit den Fachkräften. Der Kurs vermittelt ihnen das notwendige Wissen und Methoden, um Familien auch in Ernährungsfragen kompetent und zugewandt beraten zu können. Damit zahlt diese Kooperation in hohem Maße auf die Ernährungsstrategie der Bundesregierung ein.“
Die ersten 1.000 Tage prägen entscheidend das Leben
Dr. Johannes Nießen, Errichtungsbeauftragter des Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin (BIPAM) und Kommissarischer Leiter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): „Die ersten 1.000 Tage prägen entscheidend das Leben eines Menschen und somit auch sein lebenslanges Essverhalten. Mit dem Online-Kurs zur Ernährungsbildung auf der NZFH-Lernplattform können Fachkräfte von Anfang an dazu beitragen, dass Familien gesunde Essgewohnheiten entwickeln und damit auch die Eltern-Kind-Bindung stärken.“
Qualifizierungsangebot für Fachkräfte
Dr. Margareta Büning-Fesel, Präsidentin der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE): „Wir freuen uns, dass wir durch unsere fachliche Kompetenz in der Ernährungsbildung das Qualifizierungsangebot für Fachkräfte grundlegend mitgestalten konnten. Über unser großes Netzwerk tragen wir das Angebot nun in die Breite, damit möglichst viele junge Familien davon profitieren.“
Weiterführende Informationen zur Lernplattform Frühe Hilfen des NZFH finden Sie unter: https://www.fruehehilfen.de/lernplattform
Informationen und Materialien zum Thema Ernährung des Bundeszentrums für Ernährung sind verfügbar unter: https://www.bzfe.de
Zum Thema Kleinkinderernährung informiert das Netzwerk Gesund ins Leben unter: https://www.gesund-ins-leben.de
Diana Schulz, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung