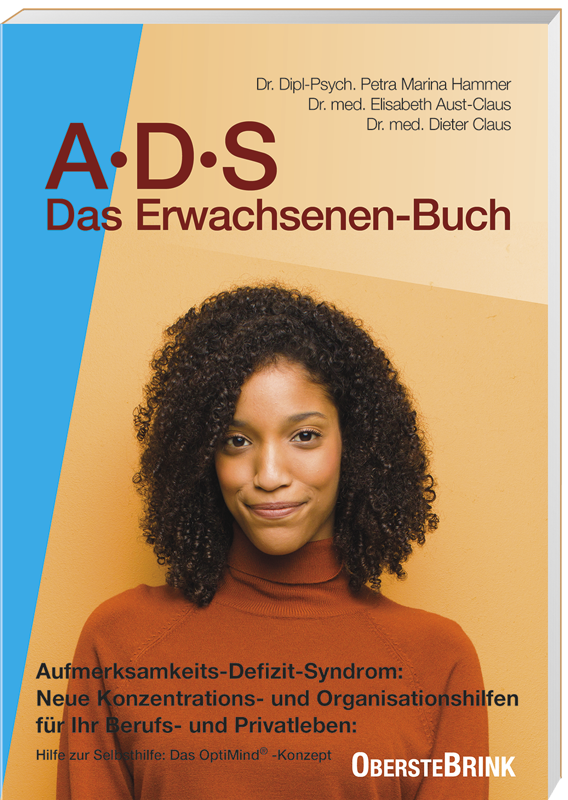Die Stiftung Kindergesundheit informiert über Mobbing in der Schule
Mobbing, ein Begriff, der sich vom englischen Wort „to mob“ ableitet, bedeutet anpöbeln, attackieren oder fertigmachen. Es beschreibt aggressives Verhalten, das von Einzelpersonen oder Gruppen gezielt gegen eine bestimmte Person gerichtet ist, um dieser zu schaden. Die Formen von Mobbing sind vielfältig.
Beim physischen Mobbing wird Gewalt oder Machtanwendung eingesetzt, wie zum Beispiel beim sogenannten „Happy Slapping“, bei dem Körperverletzungen gefilmt und in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, um das Opfer zu demütigen. Verbales Mobbing hingegen äußert sich durch extreme Beleidigungen, Beschimpfungen, Spott, Imitationen oder andere Arten von Schikanen. Soziales Mobbing erfolgt eher indirekt, etwa durch das Verbreiten von Lügen, einen Vertrauensmissbrauch, gezielte Ausgrenzung aus Gruppenaktivitäten oder das Streuen von Gerüchten und Verleumdungen. Eine besonders perfide Form ist das Cybermobbing, das digitale Medien nutzt, um anderen zu schaden und sie öffentlich bloßzustellen.
Das Ziel: eine Demütigung des Opfers
Kennzeichnend für diese Handlungen ist, dass sie auf eine Demütigung des Opfers abzielen. Dabei gibt es große Unterschiede:
• Jungen werden hauptsächlich von Jungen, Mädchen eher von anderen Mädchen, häufig aber auch von Jungen gemobbt.
• Mädchen sind signifikant häufiger Opfer von Mobbing als Jungen.
• Auch junge Menschen mit Behinderungen erleben häufiger Mobbing als Jugendliche ohne Behinderungen.
• Kinder aus finanziell benachteiligten Familien sind häufiger von Mobbing betroffen als Kinder ohne finanzielle Sorgen.
Auch die Familie leidet mit
Mobbing in der Schule ist ein ernsthaftes Problem, das nicht nur die Kinder, sondern oft auch ihre Familien vor große Herausforderungen stellt: Denn auch die Eltern leiden mit, wenn sie erfahren, dass ihr Kind von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt wird.
Mobbing in der Schule kann schwerwiegende Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit und Lebensqualität der Opfer haben, betont Dr. Frank W. Paulus, Leitender Psychologe der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Homburg/Saar.
Dr. Paulus, Mitautor des aktuellen „Jugendgesundheitsberichts 2024“ der Stiftung Kindergesundheit, berichtet: „Viele Kinder entwickeln Depressionen, Ängste oder Schlafstörungen, ziehen sich sozial zurück oder verweigern den Schulbesuch. In extremen Fällen kann die emotionale Belastung zu Selbstverletzungen oder sogar Suizidgedanken führen“.
Das Internet – ein Platz für Beleidigungen
Die zunehmende Verbreitung der digitalen Kommunikation hat die Möglichkeiten und Folgen des Mobbings deutlich erweitert und intensiviert, berichtet die Stiftung Kindergesundheit. So entwickelt sich insbesondere das Cyber-Mobbing zu einer immer öfter auftretenden Form des Psychoterrors unter Schulkindern. Dabei werden die Opfer mithilfe des Internets (z.B. über soziale Plattformen wie Facebook, TikTok, Instagram und WhatsApp) beleidigt, belästigt oder beschämt.
Aktuelle Zahlen liefert dazu die JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) 2024. Mit dieser Studie werden bereits seit 1998 die aktuellen Trends und Entwicklungen im Medienverhalten von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren untersucht. Im Rahmen der Studie gab zuletzt beinahe jede dritte teilnehmende Person an, dass über sie schon einmal beleidigende oder falsche Aussagen im Netz verbreitet worden sind.
Die Täter bleiben häufig anonym
Von beleidigenden Kommentaren im Netz berichten 57 Prozent der Befragten, von „Hate Speech“, also öffentlichen Äußerungen, die Hass gegenüber bestimmten Gruppen zum Ausdruck bringen oder zu Gewalt gegen bestimmte Gruppierungen aufrufen, berichten 40 Prozent der Jugendlichen. Jeder neunte Jugendliche beklagt sich, online auch persönlich beleidigt worden zu sein. Die Hemmschwelle ist dabei sehr gering, da die Täterinnen und Täter auf diese Weise oft anonym bleiben können.
Werden Kinder oder Jugendliche im Internet gemobbt, kann dies besonders belastend sein, weil sie sich den Angriffen kaum entziehen können, betont die Stiftung Kindergesundheit:
• Im Internet veröffentlichte Gerüchte, Bilder oder Beschimpfungen verbreiten sich schnell und sind kaum kontrollierbar.
• Weil Beleidigungen und Fotos online nahezu unbegrenzt lange abrufbar sind, wird es dem Opfer erschwert, über die Angriffe hinwegzukommen.
• Die Nutzung von gefälschten Konten (fake accounts) bietet den Täterinnen und Tätern die Möglichkeit, anonym zu agieren. Das kann die Verfolgung erschweren und Betroffene zusätzlich belasten.
Was Eltern gegen Mobbing tun können
Die Stiftung Kindergesundheit empfiehlt: Reden Sie mit Ihrem Kind über Mobbing. Ermutigen Sie es, Vorfälle in der Klasse anzusprechen, das Opfer zu unterstützen und die Lehrkräfte zu informieren. Betonen Sie, dass dies kein Petzen ist! Geben Sie Ihrem Kind außerdem Strategien an die Hand, wie es mit Konfliktsituationen umgehen kann oder Unterstützung bei Vertrauenspersonen zu suchen.
Bleiben Sie im Austausch mit Lehrkräften und der Schule. Besuchen Sie Elternabende, Sprechtage und Sprechstunden – nicht nur, um nach Noten zu fragen, sondern auch, um das Sozialverhalten und die Integration Ihres Kindes in der Klasse zu thematisieren. Ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Mobbing ist, Kinder so zu stärken, dass sie weder Opfer noch Täter werden. Eltern tragen eine wichtige Verantwortung: Sie können helfen, Mobbing zu verhindern, indem sie ihr Kind zu einem respektvollen und mitfühlenden Umgang mit anderen erziehen. So können sie zum Beispiel
• Werte wie Empathie, Rücksicht und Toleranz vermitteln, indem Eltern mit gutem Beispiel vorangehen und Kinder für die Gefühle anderer sensibilisieren. Fragen wie „Wie würdest du dich fühlen?“ können helfen.
• soziale Kompetenzen fördern, zum Beispiel durch Teamsport oder Gruppenaktivitäten, um Teamgeist, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft zu stärken.
• Konfliktlösungsstrategien lehren, etwa durch Zuhören, Verhandeln oder das Bitten um Hilfe, damit Kinder lernen, friedlich mit Konflikten umzugehen.
• eine gesunde Selbstwahrnehmung fördern, damit Unsicherheiten nicht durch Machtausübung über andere kompensiert werden.
• die eigene Vorbildfunktion wahrnehmen, indem Eltern in Stresssituationen ruhig und respektvoll reagieren, da Kinder dieses Verhalten übernehmen.
• den Umgang mit Gruppenzwang üben und Kinder ermutigen, sich solchen Dynamiken zu widersetzen und eigene Entscheidungen zu treffen.
• Medienkompetenz stärken, damit Kinder verantwortungsvoll mit sozialen Medien umgehen und die Auswirkungen ihres Handelns, wie das Teilen bloßstellender Fotos, verstehen.
• Konsequenzen von Mobbing verdeutlichen und klarmachen, dass Mobbing moralisch falsch ist und ernste Folgen haben kann.
Hier gibt es Rat und Hilfe
Die Organisation „Nummer gegen Kummer e.V.“ berät Kinder, Jugendliche und Eltern anonym telefonisch und auch online. Die Anrufe an den Beratungstelefonen sind kostenlos.
Elterntelefon unter 0800 – 111 0 550
Mo. – Fr. von 9 – 17 Uhr
Di. und Do. von 17 bis 19 Uhr
Kinder- und Jugendtelefon unter 116 111
Mo. – Sa. von 14 bis 20 Uhr
Online-Beratung für Kinder und Jugendliche per Mail und Chat unter
www.nummergegenkummer.de
https://krisenchat.de/de
Weitere Informationen:
Paulus, F.W., Möhler, E., Ohmann, S. & Popow, C. (2020). Digitale Missachtung der Bedürfnisse und Rechte von Kindern und Jugendlichen: Cybermobbing. Kinder- und Jugendmedizin, 20, 238-246.
Giulia Roggenkamp, Stiftung Kindergesundheit