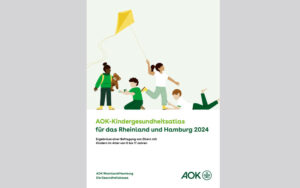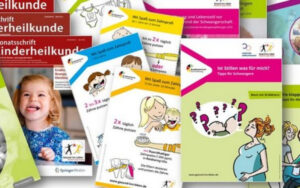RSV – die unterschätzte Gefahr für Babys und kleine Kinder

Die Stiftung Kindergesundheit informiert über eine wenig bekannte Virusinfektion
Schnupfen, Husten und Atembeschwerden sind häufige Begleiter der ersten Lebensjahre. Doch nicht nur die allgegenwärtigen Erreger von Erkältungen oder einer Virusgrippe verursachen diese Symptome bei Kindern und Erwachsenen. Hinter der Infektion steckt öfter als bisher vermutet das „Respiratorische Synzytial-Virus“, abgekürzt RSV, berichtet die Stiftung Kindergesundheit in ihrer aktuellen Stellungnahme.
Obwohl nur wenige Menschen seinen Namen kennen, füllt der tückische Krankheitserreger in den kälteren Monaten des Jahres die Betten der Kinderkliniken: Das RS-Virus ist weltweit verbreitet und die häufigste Ursache von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern. Jährlich gibt es etwa 95 RSV-bedingte Atemwegserkrankungen und 16 Krankenhausaufenthalte pro 1000 Kindern im ersten Lebensjahr. Ein schwerer Verlauf des RS-Virus lässt sich kaum vorhersagen und eine Infektion kann schlimmstenfalls sogar tödlich verlaufen.
„Das RS-Virus ist die Ursache einer besonders häufigen und belastenden Virusinfektion, die das Atmungssystem befällt. Schon bis zum zweiten Geburtstag machen nahezu alle Kinder Bekanntschaft mit dem Keim“, sagt Kinder- und Jugendarzt Prof. Dr. Johannes Liese, Leiter des Bereichs Pädiatrische Infektiologie und Immunologie an der Universitäts-Kinderklinik Würzburg und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Kindergesundheit. Er stellt fest: „Dieses Virus ist der häufigste Grund weltweit für atemwegsbedingte Krankenhausaufenthalte von Kindern in den ersten fünf Lebensjahren.“
Altersabhängige Auswirkungen einer Ansteckung
Das RS-Virus löst akute Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege in jedem Alter aus. Besonders gefährdet sind Säuglinge. „Neugeborene sind deshalb stärker anfällig, weil ihr Immunsystem noch nicht ausgereift ist“, erläutert Prof. Dr. Johannes Liese. „Aber auch ältere Frauen und Männer ab 60 Jahren gehören zur Risikogruppe.“
Medikamente zur gezielten, antiviralen Behandlung von RSV-Infektionen gibt es nicht, es stehen jedoch verschiedene Vorsorgemaßnahmen zur Verfügung. Professor Liese: „So können sich zum Beispiel werdende Mütter schon während der Schwangerschaft aktiv impfen lassen, um ihr Kind von Anfang an vor dem RS-Virus zu schützen.“
Zur RSV-Immunisierung stehen mittlerweile vier durch die EU-Kommission zugelassene Präparate zur Verfügung: Zwei davon sind Impfstoffe, zwei sind so genannte monoklonale Antikörper.
Symptome wie bei einer Virusgrippe
Die weite Verbreitung der RSV-Viren in der Bevölkerung wurde lange Zeit unterschätzt. Dabei führen sie jedes Jahr in Herbst und Winter zu ausgedehnten Epidemien.
Eine Ansteckung mit dem RS-Virus verursacht bei Säuglingen und Kleinkindern, aber auch bei älteren Erwachsenen eine Reihe von Beschwerden, die von leichten erkältungsähnlichen Symptomen bis zu schweren Atemwegserkrankungen, wie Bronchiolitis, Bronchitis oder Lungenentzündung reichen, berichtet die Stiftung Kindergesundheit.
In ihrem zeitlichen Auftreten ähneln RSV-Infektionen der Influenza. In Deutschland beginnt die RSV-Saison in der Regel im Oktober und dauert etwa drei bis fünf Monate, meist bis März.
Eine Infektion mit zwei Gesichtern
Gesunde, ältere Kinder überstehen eine RSV-Erkrankung meist ohne direkte Komplikationen. Drei bis sechs Tage nach der Ansteckung beginnt die Krankheit zunächst langsam als Schnupfen über zwei bis drei Tage. Fieber kann, muss aber nicht vorhanden sein. Nach einigen Tagen folgen dann Atembeschwerden, Schnaufen und keuchender Husten. Nach etwa vier bis sieben Tagen geht es dem Kind meist wieder besser.
Die Schwere der Erkrankung hängt allerdings stark vom Alter der betroffenen Person ab, betont die Stiftung Kindergesundheit. Bei jungen Säuglingen, Kleinkindern unter 2 Jahren, ehemaligen Frühgeborenen, immungeschwächten Patientinnen und Patienten, Kindern mit chronischen Herz- oder Lungenkrankheiten sowie bei genetischen Erkrankungen wie Trisomie 21 können die Infektionen schwerer verlaufen. Häufig treten auch asthmaähnliche Symptome, Mittelohrkomplikationen und Pseudokrupp als Begleiterscheinungen auf.
Steigt die Infektion bis zu den Lungenbläschen hinab (Bronchiolitis), wird die Atmung deutlich beeinträchtigt. Das Kind stöhnt und gibt pfeifende Geräusche („Wheezing“) von sich, beim Einatmen wird die Haut zwischen den Rippen deutlich eingezogen und die Nasenflügel weit geöffnet („Nasenflügel-Atmung“).
„Eine lebenslange Immunität vor dem RS-Virus gibt es leider nicht“, bedauert Infektions-Experte Professor Liese. „Man kann wie bei der Grippe bis in das Erwachsenenalter immer wieder daran erkranken. Erneute Infektionen sind häufig, auch da es verschiedene RSV-Typen (RSV A und RSV B) gibt.“ Bei Kindern nimmt die Erkrankungsschwere jedoch mit der Zahl der wiederholten RSV-Infektionen und dem zunehmenden Alter ab.
Risiken bei Kindern und Erwachsenen
Durch RSV besonders gefährdet sind Babys, die zu früh – vor der 35. Schwangerschaftswoche – auf die Welt gekommen sind. Ihr Immunsystem ist noch nicht voll funktionstüchtig, manchmal haben sie auch durch die Beatmung in einem Inkubator (Brutkasten) eine vorgeschädigte Lunge, heute allerdings deutlich seltener als früher.
Gefährlich werden kann eine RSV-Infektion aber auch für Säuglinge und Kleinkinder mit angeborenen Herzfehlern oder einem chronischen Lungenleiden, sowie für Kinder mit Immundefekten oder unter einer immunsuppressiven Therapie bei einer Krebskrankheit. Bei diesen Kindern liegt die Sterblichkeit nach ihrer Aufnahme in einem Krankenhaus selbst unter den heutigen intensivmedizinischen Möglichkeiten bei etwa einem Prozent.
Die meisten der erkrankten Säuglinge, die stationär versorgt werden müssen, waren zuvor jedoch gesund und keine Frühgeburten.
Bei älteren Personen ist eine Unterscheidung von RSV von anderen Viruskrankheiten wie Influenza oder SARS-CoV-2 kaum möglich, da sich die Symptome ähneln: Sie leiden unter Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit und Fieber.
Bei Kindern und Erwachsenen, die unter Asthma oder einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, verläuft die RSV-Infektion oft besonders belastend. Patienten mit einem schweren Verlauf müssen häufig stationär aufgenommen und dort im Schnitt 12 Tage lang behandelt werden. Der Anteil von Patienten, die wegen einer RSV-Infektion auf die Intensivstation gebracht werden müssen, ist um 40 bis 60 Prozent höher als bei einer Influenza.
Impfungen für Schwangere, Babys und Senioren
Zum Schutz empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) seit Juni 2024 die passive Immunisierung für alle Neugeborenen und Säuglinge in ihrer ersten RSV-Saison unabhängig von Risikofaktoren. Das Mittel wird einmalig in den Oberschenkelmuskel des Babys gespritzt. Studien haben gezeigt, dass das Risiko eines RSV-bedingten Krankenhausaufenthaltes durch diese Passivimmunisierung deutlich reduziert werden konnte. Auch die Dauer des Krankenhausaufenthaltes wird gesenkt.
Eine weitere Schutzmöglichkeit vor RSV bietet die Impfung werdender Mütter. Sie können sich schon in der Schwangerschaft impfen lassen, um ihr ungeborenes Kind durch die Weitergabe ihrer eigenen Antikörper gegen RSV zu schützen. Die mütterliche Impfung wurde Ende August 2023 zugelassen, ist bisher aber in Deutschland von der STIKO noch nicht allgemein empfohlen. Die Impfung soll die Säuglinge bis zu ihrem 6. Lebensmonat vor RSV-Infektionen schützen. Für Personen ab 60 Jahre sind zwei RSV-Impfstoffe zugelassen.
RSV-Erkrankungen sind meldepflichtig
Die Diagnose einer RSV-Infektion wird meist im Krankenhaus gestellt. Es kommen dabei Antigentests aus Nasen-Rachen-Abstrichen und Nasen-Rachen-Spülwasser zur Anwendung. Seit Juli 2023 wird eine Erkrankung an RSV dem Gesundheitsamt gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) namentlich gemeldet.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen hat die Stiftung Kindergesundheit ein Informationsvideo und einen Informationsflyer für Eltern erstellt:
https://www.powerversum.de/media/RSV_Das_Respiratorische_Synzytial_Virus.php
https://www.kindergesundheit.de/Info/_docs/SKG_RSV_Flyer_240926_final.pdf
Giulia Roggenkamp/Stifutng Kindergesundheit