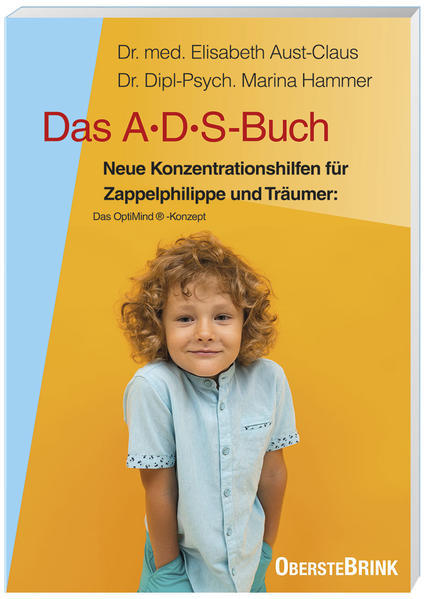Eine Skizze über die Bedeutung von zwei Grundbedürfnissen und deren Auswirkungen im Kindheitsalltag
Unser Gehirn ist entstanden, damit wir uns bewegen können. Es ist die Schaltzentrale unseres Körpers und bekommt von diesem Impulse für seine Entwicklung. Das gehört heute zu den Binsenweisheiten der Neurobiologie. Das Schöne an Binsenweisheiten ist, dass sie nicht nur simpel, sondern einfach wahr sind. Die Notwendigkeit der Bewegung ist offensichtlich auch der Grund für den natürlichen Bewegungsdrang des Menschen, speziell der Kinder. So entwickeln sich Körper und Geist weiter. Und weil Kinder ebenso einen natürlichen Spieltrieb haben, lernen sie.
Kulturtechniken wachsen nicht auf Bäumen
Der Haken dabei ist, dass sie auf diesem Weg nicht automatisch Mathematik, Lesen oder Schreiben lernen. Denn das war vor rund 200.000 Jahren, als sich die Menschheit zum Homo sapiens sapiens, also zum „verstehenden, verständigen Menschen“ entwickelte, einfach noch nicht vorgesehen. Und in der freien Wildbahn, dem ersten und wichtigsten Lernraum des Menschen, kamen keine Differentialgleichungen oder komplexe Traktate vor. Schrift und Mathematik sind erst vor 5000 bzw. 3000 Jahren entstanden. Zu kurz, als dass sich unser Gehirn darauf einstellen konnte.
Bildung als Spiel und in der Schule
Dieser Umstand hat vor allem zu Zeiten der Industrialisierung und des freien Bürgertums im 18. und 19. Jahrhundert dahin geführt, möglichst allen Kinder mithilfe von Schulen die so genannten Kulturtechniken näher zu bringen. Ab welchem Alter und in welcher Form das geschehen sollte, ist seit jeher umstritten. Die meisten Generationen haben die frühe Kindheit davon ausgenommen, um die Jüngsten spielen und toben zu lassen. Auch der Begründer des Kindergartens, Friedrich Wilhelm Fröbel, baute seine Kindergartenpädagogik auf der Erkenntnis auf, dass Bildung im frühen Kindesalter vorrangig im Spiel und nicht durch Belehrungen erfolgt.
Mangel an Möglichkeiten
Ob es jemals eine Zeit gab, in der sich Kinder auf natürliche Art und Weise entwickeln konnten, ist nicht bekannt. Ganz sicher gehören unsere modernen Zeiten nicht dazu. Im Gegenteil: Säuglinge und Kleinkinder brennen geradezu darauf, ständig Neues zu entdecken und auszuprobieren. Dabei fehlen ihnen aber allzu oft die Möglichkeiten und oftmals lassen wir sie auch nicht. In den vergangenen Jahren sei es zu einem regelrechten Boom von Angeboten zur Frühförderung gekommen, erklärt die Entwicklungspsychologin Prof. Dr. Maria Klatte. In einem Beitrag zum Thema „Gehirnentwicklung und frühkindliches Lernen“ schreibt sie: „Aus Verunsicherung, Sorge oder auch übertriebenem elterlichen Ehrgeiz sind die Terminkalender mancher Kinder so gefüllt, dass für spontane, selbst-initiierte Aktivitäten kaum noch Raum bleibt.“ In vielen Kinderbetreuungseinrichtungen sieht die Situation nicht viel besser aus. Die zahlreichen Förderprogramme unterdrücken allzu oft den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder und halten sie auf den Stühlen fest.
Mangel an Freiflächen
Daneben fehlt es zunehmend an Freiflächen, auf denen freie sportliche Aktivitäten oder einfach nur Toben möglich sind. Selbst auf den eigentlich gesetzlich geschützten Gehsteigen und in Parks können Eltern ihre Kinder kaum mehr unbeschwert laufen lassen, da diese zunehmend von Fahrrad- und E-Scooter-Fahrern okkupiert werden.
Wie viel Bewegung ein Kind braucht
Kein Wunder also, dass sich unsere Kinder zunehmend schlechter motorisch und kognitiv entwickeln. Schließlich geht beides Hand in Hand. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Kinder im Alter zwischen fünf und 17 Jahren 60 Minuten moderate bis intensive Bewegung täglich. An drei Tagen in der Woche sollten die Kinder und Jugendlichen so richtig ins Schwitzen kommen, mit aerober Aktivität von hoher Intensität, aber auch Aktivitäten, die Muskeln und Knochen stärken. Die im Sitzen verbrachte Zeit müsse zudem durch ausreichend Aktivität kompensiert werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt sogar 90 Minuten tägliche Bewegung mit mittlerer bis hoher Beanspruchung.
Die Realität sieht anders aus. Laut der 2022 erschienenen internationalen Kinder- und Jugendgesundheitsstudie „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC), an der 51 Länder beteiligt sind, bewegt sich etwa nur jedes zehnte Mädchen, jeder fünfte Junge sowie jede:r achte der gender-diversen Heranwachsenden täglich mindestens 60 Minuten am Tag. Dieser Bewegungsmangel hat schlimme Folgen für die physische und psychische Gesundheit.
Alle Menschen brauchen Musik
Noch schlechter sieht es mit einem weiteren Grundbedürfnis des Menschen aus, der Musik. In ihrer Forschungsarbeit konnte Charlotte Großmann 2020 nachweisen, dass sich das Bedürfnis nach Musik bei allen Menschen wiederfinden und sich dieses auf unterschiedliche Weise befriedigen lässt.
Was Musik für Kinder bedeutet
Was Musik für Kinder bedeutet, ist unter anderem im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan festgehalten. „Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Mit Neugier und Faszination begegnen sie der Welt der Musik. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umgebung zu lauschen, diese selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften von Materialien aktiv zu erforschen. Gehörte Musik setzen Kinder in der Regel spontan in Tanz und Bewegung um.“, ist hier zu lesen. Weiter ist hier zu lesen: „Die Vielfalt der Sinneswahrnehmungen durch das ,Spiel mit Musik‘ bietet in den ersten Lebensjahren grundlegende Anregungen. Neben ihrem ästhetischen Selbstwert verfügt sie über weit reichende entwicklungspsychologische Effekte. Der aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes.“
Wie Musik die Entwicklung des Menschen untersützt
Die Autorinnen und Autoren stellen anschließend die Bedeutung der Musik für das Wohlbefinden, für Ausdruck, Fantasie und Kreativität, Sozialkompetenzen, kulturelle Identität und interkulturelle Kompetenz, Sprachkompetenz, aufmerksames Zuhören, kognitive Kompetenzen, Körperbewusstsein und motorische Kompetenz heraus. Nach diesem beeindruckenden Bekenntnis zur Bedeutung von Musik sollten wir eigentlich nun getrost davon ausgehen können, dass die bayerischen Kinder stetig mit dem Musikzieren und Tanzen beschäftigt sind.
Musik und Alltag
Die Realität sieht jedoch genauso trist aus, wie in zahlreichen anderen Bundesländern. Schlimmer noch! Im südlichen Bundesland legt man derzeit den Musik-, Kunst- und Werkunterricht in der Grundschule zusammen und kürzt den Stundenanteil auf vier Stunden pro Woche. Lesen, Schreiben und Rechnen werden laut dem Beschluss des Bayerischen Kabinetts dagegen ausgebaut. Man will eben fördern, was der Wirtschaft nutzt. Der Grund ist in den schlechten Ergebnissen bei IQB und PISA zu finden. Dabei gälte es doch, diese Ergebnisse deutlich zu hinterfragen. Liegt es an der Digitalisierung, dem Gemeinschaftsschulsystem oder dem geringen Migrantenanteil, dass Estland so viel besser abgeschlossen hat? Möglich das Südkorea vor allem deshalb so gut abschneidet, weil dort nur ausgewählte, hochmotivierte Schüler am PISA-Test teilnehmen durften, während hierzulande unsere 15-Jährigen keine Wahl hatten. Vielleicht reagieren auch Länder wie Schweden, Frankreich oder Neuseeland richtig, die auf die schlechteren Ergebnisse mit dem Rückbau der Digitalisierung reagieren?
Solche Überlegungen sind dem Bayerischen Kabinett offenbar fremd und die Ministerinnen und Minister wissen offenbar auch nichts von der Bedeutung von Musik für Kinder. Einen jämmerlichen Trost gibt es: Sie stehen damit nicht allein. Für die Wirtschaft ist das dennoch ein Bärendienst. Schließlich unterdrückt die Bayerische Staatsregierung auf diesem Weg zunehmend die Entwicklung der sozialen Fähigkeitenu und der Kreativität.
Musik ist Seelenproviant für Kinder
In seinem „Plädoyer für mehr Musik und Tanz in Kindertagesstätten“ schreibt Prof. Armin Krenz „Musik ist Seelenproviant für Kinder“. „Musik ist weitaus mehr als nur eine bloße Aneinanderreihung von Noten, eingebettet in bestimmte Takte. Musik setzt Energien frei, die offensichtlich innere Impulse in Gang setzen, die das ,reine Hören‘ erweitern wollen, Emotionen ansprechen und vielfältige Ausdrucksformen aktivieren, die sich schließlich in sichtbare und rhythmische Bewegungsaktivitäten umsetzen.“ Mit Blick auf die Bedeutung der Musik ruft er jede Kita dazu auf, das aktive Musikerleben stärker als bisher zu unterstützen und ihre Alltagspraxis daraufhin überprüfen, inwieweit ihre Musikpraxis auch einen hohen Stellenwert einnimmt.
Die Entfernung von den Grundbedürfnissen bedeutet Entfremdung vom Menschsein
Das Ergebnis dürfte für viele ernüchternd ausfallen. Vor allem im Zuge der zunehmenden Verschulung des Kindergartens nimmt man den Kindern ihre Kindheit. Während die Orff-Instrumente auf den Regalen verstauben, gibt es nun Sprachförderung auf dem Tablet. Dabei ließe sich Sprachförderung mit Instrumenten doch viel sinnlicher und sinnvoller gestalten. Bewegung und Musik sind Urbedürfnisse des Menschen. Indem wir Kinder darin einschränken, entfernen wir sie von sich selbst und verwehren ihnen grundlegende Erfahrungen. Es bleibt also zu hoffen, dass die Entwicklungen und Studien im internationalen Bereich auch hierzulande Früchte tragen.
Quellen:
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zu Einschulung, 5. Auflage, Cornelsen, 2012
Großmann, Charlotte: Die Bedeutung von Musik für den Menschen – Musizieren als Grundbedürfnis, Hochschule Darmstadt, 2020
Kinder- und Jugendgesundheitsstudie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) in Journal of Health Monitoring, Robert Koch Institut, 2024
Klatte, M. (2007). Gehirnentwicklung und frühkindliches Lernen. In: Brokmann-Nooren, Ch.; Gereke, I.; Kiper, H. & Renneberg, W. Bildung und Lernen für die Drei- bis Achtjährigen. S. 117-139. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Körner, Gernot: Bewegung bringt das Gehirn erst in Schwung – Warum körperliche Aktivität das Lernen fördert, spielen-und-lernene.online, 2023
Krenz, Armin: Musik ist Seelenproviant für Kinder – Ein Plädoyer für mehr Musik und Tanz in Kindertagesstätten, spielen-und-lernen.online, 2022
Gernot Körner