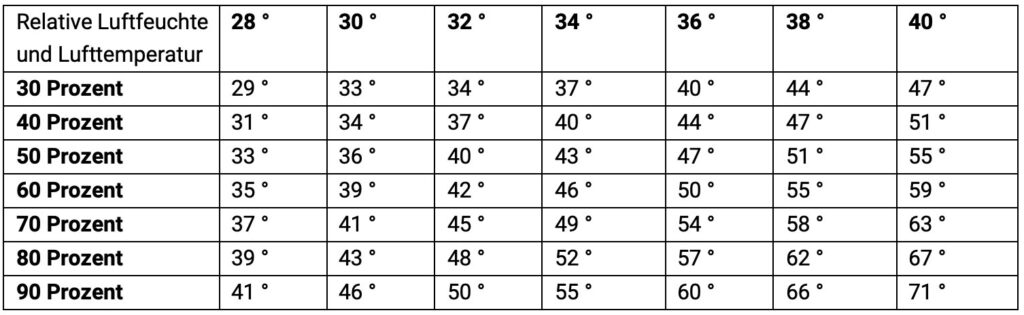Besonders die Nuggets von Burger King und Iglo schneiden im Test schlecht ab
Die Chicken Nuggets von Burger King und Iglo sind Testverlierer beim Verbrauchermagazin Öko-Test. Sie überzeugen die Tester weder mit ihren Inhaltsstoffen noch in Sachen Tierwohl und Transparenz. „Ungenügend“ lautet deshalb ihr Gesamturteil. Der Öko-Test-Vergleich von Chicken Nuggets macht insgesamt einige Probleme deutlich:
- Elf Chicken Nugget-Marken aus der Tiefkühlabteilung, darunter vier Bio-Produkte, hat Öko-Test unter die Lupe nehmen lassen. Mit dabei waren auch die Nuggets der drei Fast-Food-Ketten McDonald’s, KFC und Burger King.
- Eingeschränkt empfiehlt Öko-Test drei Chicken-Nugget-Marken mit „gut“. Was das Tierwohl betrifft, sei aber Luft nach oben.
- Für die meisten Anbieter im Test ist Haltungsstufe 2 anscheinend der Standard.
- Bei den Inhaltsstoffen kritisieren die Tester vor allem Fettschadstoffe und einen antibiotikaresistenten Keim.
- Burger King und Iglo sind die Testverlierer.
Dagegen sind vegane Nuggets frei von Tierleid. Die Inhaltsstoffe vieler Produkte im Test floppen allerdings. Etliche vegane Nuggets fallen aufgrund von enthaltenen Schadstoffbelastungen und umstrittenen Zusatzstoffen negativ auf. Vier Produkte sind immerhin mit „gut“ empfehlenswert.
- Im Test waren 17 vegane Nuggets auf Basis von Tofu, Reisflocken oder von Soja-, Weizen- Ackerbohnen- oder Erbseneiweiß, darunter tiefgekühlte und gekühlte aus Supermärkten und Discountern. Außerdem: fertig zubereitetes Fast Food von McDonald’s und Burger King.
- Vier Produkte sind mit „gut“ empfehlenswert, sieben fallen mit „ungenügend“ durch.
Burger King und Iglo sind Testverlierer
- Bei den Chicken Nuggets gab Burger King die denkbar schlechteste Auskunft zum Thema Tierwohl: Als einziges Unternehmen im Test beantwortete die Fastfood-Kette die Fragebögen von Öko-Test offenbar gar nicht. Auch das Testergebnis Inhaltsstoffe der King Nuggets fällt „ungenügend“ aus.
- Zweites Schlusslicht im Test: die Chicken Nuggets classic der beliebten Tiefkühlmarke Iglo. Wie in den King Nuggets fand das Labor auch darin Fettschadstoffe.
So steht es um Schadstoffe in Chicken Nuggets
In Sachen Schadstoffe stehen die meisten Chicken Nuggets ganz gut da. Anders als in vielen der veganen Produkte sind Mineralölbestandteile hier kein großes Thema. Die Nuggets von Burger King und Iglo fallen aber aus dem Rahmen.
Das beauftragte Labor hat darin Gehalte an 3-MCPD-Fettsäureestern ermittelt, die als „erhöht“ eingestuft wurden. Die Stoffe können sich in verarbeiteten Lebensmitteln, etwa in raffinierten pflanzlichen Ölen bilden. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat 3-MCPD als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft.
Da auch Kinder Chicken Nuggets lieben, hat Öko-Test für die Bewertung ein Kind mit 30 Kilogramm Körpergewicht zugrunde gelegt: Mit einer Portion von 150 Gramm würde es schon mehr als die Hälfte der täglich tolerierbaren Aufnahmemenge (TDI) ausschöpfen, die die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) festgelegt hat.
Manche Nuggets bestehen zu großem Teil aus Panade
Die Nuggets von Burger King und Iglo fielen auch durch ihren überproportional großen Anteil an Panade im Verhältnis zum Fleisch negativ auf. Dafür, dass sie zu mehr als 40 Prozent aus Panade bestehen, kritisieren die Tester auch weitere Chicken Nuggets im Test.
Bei Burger King kommt noch ein Phosphatzusatz hinzu, auf den Fertiglebensmittelhersteller aus unserer Sicht besser verzichten sollten, da zu viel Phosphat den Nieren schaden kann. Weiterer Kritikpunkt: Die Fast-Food-Kette hat keine komplette Zutatenliste auf ihre Internetseite gestellt.
Mineralöl in veganen Nuggets gefunden
Mehr als die Hälfte der Produkte im Test kritisieren die Tester, weil sie mit Mineralölbestandteilen verunreinigt sind. Genau gesagt, handelt es sich um gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH/MOSH-Analoge). Diese reichern sich im menschlichen Körper an und stellen dort die größte Verunreinigung dar. Die gesundheitlichen Folgen sind unklar.
Die aktuell getesteten Chicken Nuggets enthielten allenfalls Spuren von MOSH-Analogen. Sind Verunreinigungen mit Mineralöl also ein spezielles Problem von veganen Ersatzprodukten? Klares Nein. Auch in Butter oder in Grillwürsten aus Schweinefleisch fand Öko-Test Mineralölbestandteile.
Die Lebensmittelindustrie hat sich seit Längerem selbst verpflichtet, auch MOSH-Analoge in Lebensmitteln vorsorglich zu minimieren. Aus Sicht von Öko-Test sind die bisherigen Anstrengungen und Orientierungswerte aber nicht ambitioniert genug.
Was ist in den veganen Nuggets drin?
Die veganen Nuggets basieren auf Tofu, Reisflocken oder auf Soja-, Weizen- Ackerbohnen- oder Erbseneiweiß. Die Grundstoffe sind pflanzlich. Vegane Nuggets bleiben aber industriell hergestellte Fertigprodukte, zum Teil mit jeder Menge Zusatzstoffen.
Viele versuchen dem Produkt aus Huhn möglichst nahezukommen. Dafür setzen die Anbieter nicht nur auf Gemüse oder Getreide, sondern unter anderem auch auf Verdickungsmittel oder einzelne pflanzliche Fasern fürs entsprechende Mundgefühl.
Einige der Zusatzstoffe sehen die Tester kritisch. So taucht mit wenigen Ausnahmen in allen Zutatenlisten Aroma oder „natürliches Aroma“ auf. Statt auf geschmacksintensive leckerere Rohstoffe setzen die Hersteller auf die Trickkiste der Aromenindustrie. Dass einige damit den Geflügelfleischgeschmack nachahmen wollen, muss nicht sein.
Phosphatzusätze in einigen veganen Nuggets
Aromazusätze zeigen für Öko-Test klar das Problem dieser Produktkategorie: Offenbar schmecken die Rohstoffe nicht intensiv und lecker genug. Aus unserer Sicht schmälern Aromazusätze die Qualität eines Lebensmittels.
Was steckt außerdem in den veganen Nuggets? In einigen Produkten wurden Phosphatzusätze gefunden. Phosphate sind natürlicherweise besonders in tierischen Lebensmitteln, aber auch in Hülsenfrüchten enthalten.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat 2019 darauf hingewiesen, dass Kinder leicht mehr Phosphate aufnehmen können, als für sie gesundheitlich unbedenklich ist. Große Mengen an Phosphaten können den Nieren schaden.
Zwei Produkte sind mit Eisen (Eisendiphosphat) angereichert. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät von Eisenzusätzen in Lebensmitteln ab. Wer unter Eisenmangel leidet, nimmt besser mit ärztlicher Rücksprache die individuell richtige Dosis ein.
Geschmack
In der Prüfung von Aussehen, Geschmack und Geruch schlugen sich fast alle Chicken Nuggets „gut“ bis „sehr gut“ – bis auf wenige Produkte. Die Kritik der Experten: „außen nicht knusprig“, „innen zu weich“ oder „gummiartiger Kern und Panade“.
Echte Ausreißer nach unten in Geschmack, Aussehen und Mundgefühl gab es auch bei den veganen Nuggets nicht. Die geschulten Sensoriker notierten nur leichte Abweichungen wie „nicht knusprige Panaden“ oder einen vergleichsweise „faden Geschmack“. Am unangenehmsten war noch der „schwach muffige“ Geruch eines Produkts im Test.
Insgesamt müssen die veganen Nuggets sich im Testergebnis Sensorik nicht vor den Chicken-Nuggets verstecken.
Vegane Nuggets vs. Chicken Nuggets
- Tierwohl: Für die veganen Nuggets leiden keine Tiere – für solche aus Huhn durchaus.
- Klima: Hähnchen-Nuggets haben laut Ifeu-Institut einen Fußabdruck von 3,8 Kilogramm CO2-Äquivalenten pro Kilo Produkt. Im Vergleich mit Rindfleisch (13,8 Kilo) ist das wenig, aber viel im Vergleich mit den meisten pflanzlichen Lebensmitteln. Einen direkten Vergleichswert für vegane Nuggets hat das Institut nicht veröffentlicht, für andere vegane Fleischersatzprodukte liegen Werte von unter zwei Kilo vor.
- Nährstoffe: Chicken- und auch viele vegane Nuggets liefern viel Eiweiß und kaum ungünstige gesättigte Fette. Trotzdem sind sie kein besonders gesundes Essen. 150 Gramm veganes Produkt im Test enthalten bis zu 458 Kilokalorien, die Chicken-Variante bis zu 374.
Mehr dazu finden Sie auf www.oekotest.de. Hier finden Sie auch die Tests zum kostenpflichtigen Download. Die aktuelle Ausgabe des Magazins zu weiteren Produkten wie Bodysprays, Fußbalsam, Vitaminpräparate für Schwangere, Babyfeuchttücher mit Parfüm und Lackfarben ist ab sofort im Handel erhältlich.
Quelle: Pressemitteilung Öko-Test