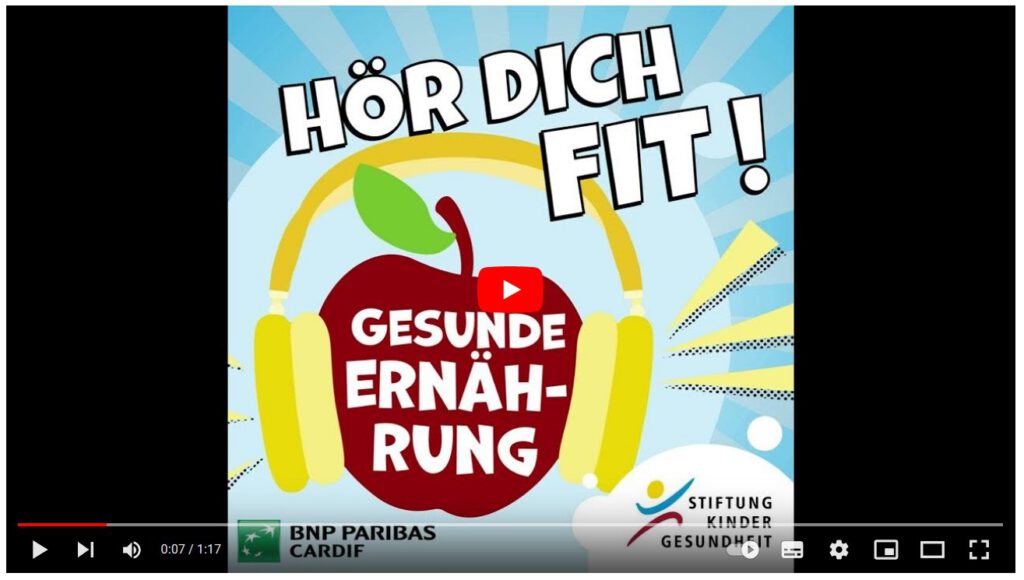Die Stiftung Kindergesundheit informiert über Autismus-Spektrum-Störungen
Autismus ist eine durch genetische und umweltbedingte Faktoren verursachte Störung der Gehirnentwicklung im frühen Kindesalter. Experten registrieren weltweit übereinstimmend eine starke Zunahme der Störung in den letzten Jahren. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass der Anteil autistischer Menschen an der Gesamtbevölkerung bei etwa einem Prozent liegt. Das betrifft in Deutschland ungefähr 800.000 Frauen und Männer, berichtet die in München beheimatete Stiftung Kindergesundheit in einer aktuellen Stellungnahme.
„Viele autistische Kinder haben große Schwierigkeiten, Kontakte zu anderen Menschen, manchmal sogar zu den eigenen Eltern aufzunehmen“, sagt die Münchner Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Priv.-Doz. Dr. med. Katharina Bühren, ärztliche Direktorin des kbo-Heckscher-Klinikums und Vorstandsmitglied der Stiftung Kindergesundheit. „Diese Kinder sind nicht wie ihre Altersgenossen in der Lage, die Stimmungen oder Absichten anderer Menschen zu erfassen und weichen selbst von liebevollen Berührungen zurück, weil sie deren Absicht nicht erkennen können“.
Schon als Babys verhalten sie sich etwas seltsam
Eine autistische Störung kündigt sich meist bereits in den ersten 24 Lebensmonaten an, berichtet die Stiftung Kindergesundheit. So sind autistische Babys oft übermäßig ruhig und Liebkosungen gegenüber gleichgültig. Sie reagieren nicht oder nur verzögert auf Ansprache und sind zum Beispiel teilnahmslos oder sogar ablehnend, wenn man sie auf den Arm nimmt. Sie suchen keinen Blickkontakt, lächeln nicht zurück und reichen den Eltern nicht die Arme entgegen. Auch die Sprachentwicklung ist zum Teil verzögert oder sogar schwer gestört.
Mit zunehmendem Alter entwickelt sich dann meistens eine mehr oder weniger starke emotionale Beziehung zu den Eltern und anderen vertrauten Personen. Freundschaften mit Gleichaltrigen sind jedoch rar, auch gemeinsames Spielen findet nur selten statt. „Den Kindern mangelt es an Einfühlungsvermögen“, erläutert die Kinder- und Jugendpsychiaterin: „Sie können sich nicht in jemand anderen hineinversetzen und leben in ihrer eigenen Gedanken- und Vorstellungswelt.“
Autismus wurde von den Fachleuten lange in „Frühkindlicher Autismus“, „Asperger-Syndrom“ und „Atypischer Autismus“ eingeteilt. Da sich die Formen überschneiden und unterschiedliche Ausprägungsgrade auftreten können, wird heute der Oberbegriff Autismus-Spektrum-Störungen verwendet (englisch: Autism spectrum disorder, ASD).
Bei impfskeptischen Menschen hält sich hartnäckig die Annahme, Autismus könne durch Impfungen verursacht werden. Diese Behauptung ist durch mehrere Studien wissenschaftlich eindeutig widerlegt worden, unterstreicht die Stiftung Kindergesundheit.
Unvermittelte Wutausbrüche wegen Lappalien
Autistische Kinder „leiden“ nicht, zumindest nicht körperlich: Sie haben kein Fieber, müssen keine Schmerzen ertragen oder krank das Bett hüten. Dennoch können auch autistische Kinder Qualen empfinden und zwar oft aus Gründen, die kaum jemand versteht – meist nicht einmal ihre Eltern: Fremde Dinge, die sie hören, sehen, fühlen, schmecken oder riechen, lösen bei autistischen Kindern oft ungewöhnliche Reaktionen oder unberechenbare Wutausbrüche aus. Manche Betroffene können glitschige oder klebrige Dinge nicht anfassen, andere lehnen Mahlzeiten schon wegen ihrer ungewohnten Konsistenz, ihres (grünen) Aussehens oder ihres neuen, noch unvertrauten Geschmacks ab.
Betroffene haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Struktur und Vorhersehbarkeit, brauchen Routinen und vertraute Abläufe, die ihnen Sicherheit geben. Sie haben Angst vor Neuem und möchten am liebsten alles immer beim Alten behalten. Schon kleinste Veränderungen, wie zum Beispiel das Umstellen eines Möbelstücks, bringen sie zur schieren Verzweiflung und unvermittelt zum Ausrasten.
Zwanghafte Wiederholung von Bewegungen
Nicht selten zeigen autistische Kinder ritualisierte Handlungen, die oft automatenhaft wiederholt werden. Dazu gehören zum Beispiel das Berühren verschiedener Gegenstände in der stets gleichen Reihenfolge, das zwangartige Wiederholen bestimmter Bewegungsabläufe wie zusammenhangloses Händeklatschen oder Haareausreißen, rhythmisches Kopfanschlagen, Schaukeln, Drehen, Hochschnellen und Zucken oder statuenhaftes Ausharren in einer bestimmten Position. Eine häufige Angewohnheit ist auch die sogenannte „Echolalie“, die Neigung, Laute und Worte anderer Personen zu wiederholen. So antwortet ein autistisches Kind auf die Frage „Hast Du Hunger?“ vielleicht mit demselben Satz „Hast Du Hunger?“, weil es weiß, dass es nach diesem Satz meist etwas zu Essen gibt.
Bei manchen Kindern bilden sich starke Beziehungen heraus zu scheinbar wertlosen Gegenständen wie zum Beispiel Gummibändern oder Bindfäden, und sie sind unter Umständen heftig erregt, wenn man ihnen diese Dinge wegnimmt.
Spezialisten mit phänomenalen Fähigkeiten
Einige autistische Kinder sind überdurchschnittlich intelligent und entwickeln sich zu wahren Expert*innen auf einem bestimmten Gebiet. Betroffene mit so einer sogenannten Inselbegabung werden Savants genannt. Sie haben oft geradezu phänomenale Fähigkeiten zu abstraktem und logischem Denken und geben sich häufig sehr speziellen Interessen hin, in denen sie auch Großes zu leisten vermögen.
Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten leben mit Autismus, zum Beispiel die Klima-Aktivistin Greta Thunberg, die Milliardäre Bill Gates und Elon Musk oder der Hollywood-Regisseur Steven Spielberg. Auch Einstein und Mozart und der Pop-Künstler Andy Warhol sollen Autisten sein bzw. gewesen sein.
Viele bekennen sich zu ihrer Störung. Ein von Autismus Betroffener schrieb vor einigen Jahren in der „New York Times“: „Wir haben keine Krankheit, und deswegen können wir nicht geheilt werden. Wir sind einfach so“.
ADHS – eine häufige Begleitstörung
Kinder mit Autismus neigen auch noch zu einer Reihe weiterer psychischer Begleitstörungen, wie zu übergroßen Befürchtungen, Phobien, Schlaf- und Essstörungen sowie zum herausfordernden Verhalten in Form von Wutausbrüchen und fremd - oder selbstverletzenden Verhaltensweisen.
Fast jede*r Zweite ist auch von einer Aufmerksamkeits-Defizit-Störung ADHS betroffen, Jungen häufiger als Mädchen.
Manche ihrer Kommunikationstörungen lassen mit der Zeit etwas nach, die meisten autistischen Kinder jedoch haben auch im Erwachsenenalter noch soziale und partnerschaftliche Probleme, weiß PD Dr. Katharina Bühren zu berichten.
Die Schuld liegt nicht bei den Eltern!
Die Ursache von Autismus ist immer noch ungeklärt. Fest steht jedoch, dass die Schuld an den Verhaltensstörungen nicht an Erziehungsfehlern der Eltern liegt, betont die Stiftung Kindergesundheit.
Vermehrter Konsum digitaler Medien ab dem frühen Kleinkindalter scheint mit der Entwicklung von autistischen Zügen in Verbindung zu stehen – durch die verminderte echte soziale Interaktion können diese Kinder Gefühle und Verhaltensweisen anderer Menschen schlechter einschätzen und adäquat auf sie eingehen.
Aufgrund von deutlichen Fortschritten in der Forschung können heute immer häufiger genetische Veränderungen als Ursache identifiziert werden.
Ist eine Behandlung möglich?
Zur Behandlung von autistischen Störungen steht in Deutschland eine Reihe von therapeutischen Verfahren zur Verfügung. Für die Kernsymptomatik der Autismus-Spektrum-Störung gibt es allerdings bis heute kein Verfahren und Medikament, das einen völligen Rückgang der autistischen Symptome erreichen könnte.
Die aktuellen Leitlinien zur Therapie empfehlen grundsätzlich verhaltenstherapeutisch-übende Verfahren, da für derartige Methoden die besten Wirksamkeitsnachweise vorliegen. Durch solche Therapien, die möglichst früh beginnen sollten, können insbesondere die soziale Interaktion und die Fähigkeiten der betroffenen Kinder (und Erwachsenen) zur Kommunikation verbessert und ihre herausfordernden und seltsam anmutenden Verhaltensweisen reduziert werden.
Doch die Kapazitäten der Therapiezentren geraten derzeit zunehmend an ihr Limit, beklagen Prof. Dr. Heidrun Thaiss und Prof. Dr. Volker Mall, Präsident*innen der Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin. Der wesentliche Grund hierfür ist der personelle Engpass in fast allen medizinischen, psychosozialen und therapeutischen Berufen, der sich auch in den Autismus-Therapiezentren zeigt.
Hier gibt es weitere Informationen
Selbsthilfe-Organisationen von Autist*innn und Eltern autistischer Kinder benutzen häufig die Bezeichnungen „Auties“ (für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen) und „Aspies“ (für Menschen mit Asperger-Syndrom), um zu verdeutlichen, dass der Autismus ein Teil ihrer Persönlichkeit ist. Viele haben sich zu Selbsthilfe-Organisationen zusammengeschlossen. Hier einige Beispiele:
Bundesverband autismus Deutschland e.V.
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg
Telefon: 040/5 11 56 04, Fax: 040/5 11 08 13 E-mail: info@autismus.de, Internet: www.autismus.de
Verein „Autismus deutsche Schweiz“
Riedhofstrasse 354,
CH-8049 Zürich
Internet: www.autismus.ch
E-mail: anfrage@autismus.ch
Österreichische Autistenhilfe
Eßlinggasse 17
1010 Wien
Telefon: +43 (1) 533 96 66 – 0
E-Mail: office@autistenhilfe.at
Weitere Internet-Adressen:
www.autisten.enthinderung.de, www.autismus.ra.unen.de,
www.aspies.de
Giulia Roggenkamp, Stiftung Kindergesundheit