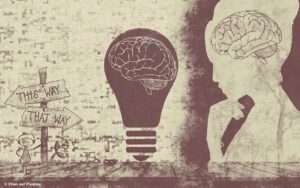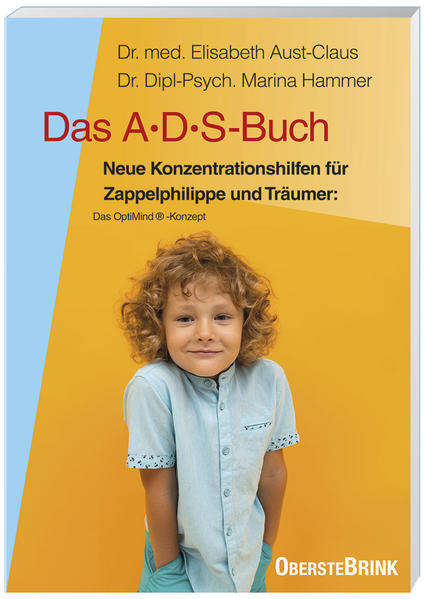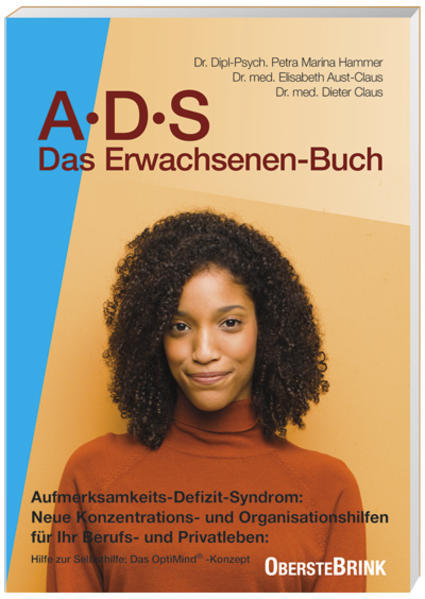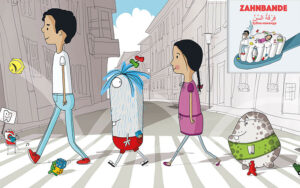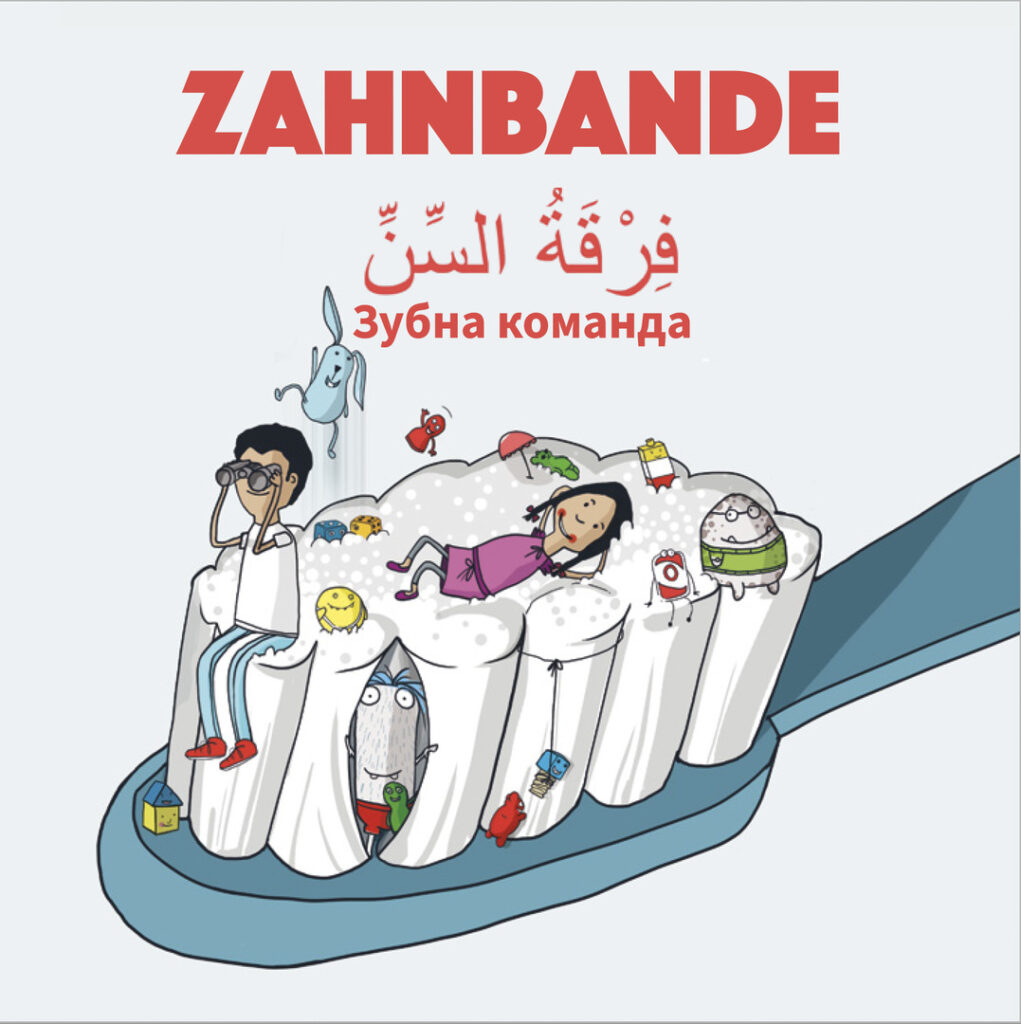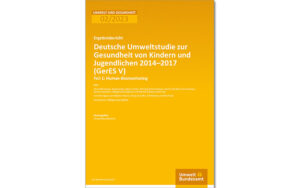Wer 10 Minuten länger am Tisch sitzt, isst einen Apfel mehr

Kinder essen mehr Obst und Gemüse, wenn sich Familien mehr Zeit für ihre Mahlzeiten lassen
Kinder verzehren deutlich mehr Obst und Gemüse, wenn sie durchschnittlich nur zehn Minuten länger am Tisch saßen als sonst – also insgesamt 30 Minuten. Das konnten Prof. Dr. Jutta Mata von der Universität Mannheim und Prof. Dr. Ralph Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin mit eienm Experiment nachweisen. Im Durchschnitt aßen die Kinder etwa 100 Gramm mehr Obst und Gemüse. Das entspricht etwa einer der fünf empfohlenen täglichen Portionen Obst und Gemüse und ist so viel wie ein kleiner Apfel oder eine kleine Paprika. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in der US-Fachzeitschrift JAMA Network Open veröffentlicht.
Täglich eine zusätzliche Portion Obst, senkt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
„Diese Erkenntnis hat praktische Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, da eine zusätzliche Portion Obst und Gemüse täglich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um sechs bis sieben Prozent verringert“, erklärt Professorin Mata. „Für einen solchen Effekt muss natürlich genügend Obst und Gemüse auf dem Tisch vorhanden sein – am liebsten mundgerecht“, fügt die Gesundheitspsychologin hinzu.
50 Eltern und 50 Kinder nahmen an der Studie teil. Das Durchschnittsalter der Kinder lag bei acht und das der Eltern bei 43 Jahren. Es nahmen gleich viele Jungen und Mädchen an der Studie teil. Den Teilnehmenden wurde ein typisch deutsches Abendbrot mit Brotscheiben, Aufschnitt und Käse sowie mundgerechten Obst- und Gemüsestücken serviert.
Dauer der Mahlzeit ist eine der zentralen Kompetenten der Familienmahlzeit
„Die Dauer der Mahlzeit ist eine der zentralen Kompetenten der Familienmahlzeit, die Eltern variieren können, um die Ernährungsgesundheit ihrer Kinder zu steigern. Auf diesen Zusammenhang hatten wir bereits Hinweise in einer Metaanalyse gefunden, die Studien zusammenfasste, die qualitative Komponenten von gesunden Familienmahlzeiten untersuchten. Jetzt konnten wir diesen damals nur korrelativen Zusammenhang in dieser neuen experimentellen Studie eindeutig nachweisen,“ sagt Ralph Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Die Studie belegt zudem, dass längere Familienmahlzeiten nicht dazu führten, dass Kinder auch mehr zu Brot oder Aufschnitt griffen, sie nahmen auch nicht mehr Dessert. Die Forschenden vermuten, dass das in mundgerechte Stücke geschnittene Obst und Gemüse bequemer zu essen und daher verlockender war.
Hier geht es zur Originalpublikation
Link zur Metaanalyse
Linda Schädler