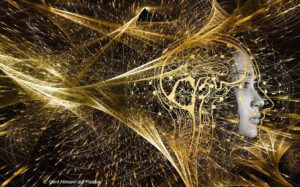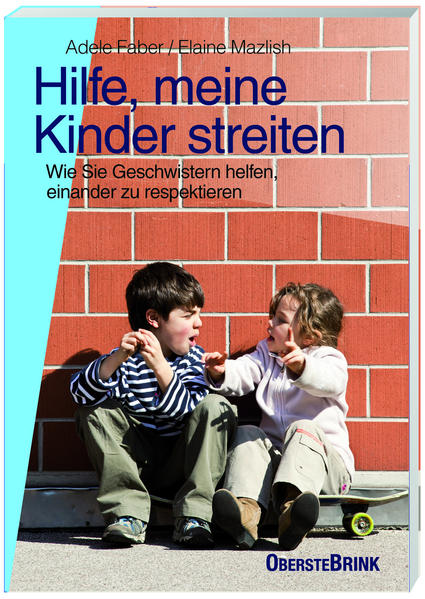Kinderherzen vor Hitzewelle schützen

Der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. gibt Tipps nicht nur für Familien mit herzkranken Kindern
In den kommenden Tagen ist eine Hitzewelle angekündigt. Die hohen Temperaturen belasten vor allem auch herzkranke Kinder. Säuglinge und Kleinkinder neigen am stärksten zur Überhitzung, weil sie Temperaturen noch nicht wirksam regulieren können. Vor allem bei schwüler Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit ist die Wärmeableitung über die Haut bzw. Schweißbildung kaum möglich. Hohe Ozonwerte können zu akuten Atembeschwerden mit Husten oder zu akuten Asthmaanfällen führen. Vermeiden Sie auch vermeintlich harmlose Sonnenbrände „nur mit Hautrötung“ und ohne Blasenbildung. Denn zu viel UV-Strahlung steigert sowohl das Risiko, dass die zarte Kinderhaut geschädigt wird, als auch dass das Kind später an Hautkrebs erkranken kann. Hier einige Tipps für Kinder:
Trinken
Je höher die Temperaturen, desto schneller trocknen Kinder aus. Bei ihnen beträgt der Wasseranteil am Körpergewicht etwa 75 Prozent. Ihre Körperoberfläche ist vergleichsweise viel größer als die von Erwachsenen. Geben Sie daher ihren Kindern regelmäßig und ausreichend zu trinken, am besten Wasser, ungesüßten Tee oder Fruchtsaftschorlen – nicht zu kalte Getränke, da der Körper dies kaum kompensieren kann.
Alkohol
Experimente mit Alkohol und anderen Drogen können böse enden. Denn Alkohol beeinträchtigt das Herz- Kreislaufsystem und kann die Wirkung von Herzmedikamenten negativ beeinflussen. Altersgerechte Info dazu gibt es auch auf www.herzklick.de und in unseren Comics auf: https://www.bvhk.de/….
Ernährung
Leichte, fettarme Kost belastet das Herz nicht übermäßig.
Sonnenschutz
Enge und helle Kleidung aus Baumwolle schützt weniger gut vor Sonnenstrahlung als weite und dunkle Kleidung oder gekennzeichnete UV-Schutzkleidung (mindestens mit Lichtschutzfaktor 40). Sonnenschutzcreme mit dem jeweils richtigen Lichtschutzfaktor und aktuellem Haltbarkeitsdatum regelmäßig auftragen. Nachcremen, vor allem nach dem Baden oder Schwitzen nicht vergessen. Auch die Augen brauchen Schutz. Unbedingt darauf achten, dass auch die Brille UV-A- und UV-B-Strahlen abhält!
Kindergarten und Schule informieren
Eltern herzkranker oder chronisch Kinder sollten Erzieher:innen bzw. Lehrer:innen ihres herzkranken Kindes informieren: wie belastbar ist das Kind? Welche besondere Fürsorge braucht es? Welche Medikamente? Was ist im Notfall, etwa bei einem Schwächeanfall, zu beachten? Hilfreich ist die Broschüre „Herzkranke Kinder in der Schule“ auf https://www.bvhk.de/….
Aktivitäten
Chronisch herzkranke Kinder sollten in der Mittagshitze nicht draußen spielen. Auf Ausflügen brauchen sie ihre gewohnten Medikamente. Wenn diese gekühlt werden müssen, sollten die Eltern Kühlmöglichkeiten für unterwegs sicherstellen.
Sport
Sport in sengender Sonne ist nicht ratsam. Rennen in der Hitze ist viel anstrengender als bei normalen Temperaturen. Gut tun jetzt Entspannungsübungen im Schatten. Am besten in den Morgen- oder Abendstunden, wenn es etwas kühler ist.
Schwimmen und Tauchen
Überhitzt ins Wasser springen belastet den Kreislauf stark. Besser reibt sich das Kind nach und nach mit dem kalten Wasser ab und taucht dann erst mit dem ganzen Körper ein.
Medikamente und ihre Nebenwirkungen
Die Nebenwirkungen sind bei hohen Temperaturen teilweise extrem. Arzneimittel können die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen und damit auch die Lern- und Leistungsfähigkeit sowie die Sicherheit im Straßenverkehr.
„Mein Herz rast so!“
Kinder mit Herzrhythmusstörungen sind jetzt besonders gefährdet. Rhythmusstörungen können trotz Medikation auftreten. Wenn ein Kind über ‚Herzrasen‘ klagt, sollte die Hautoberfläche gekühlt werden. Es sollte sich hinsetzen, wenn möglich im Schatten hinlegen. Manchmal verschwinden diese Herzrhythmusstörungen spontan wieder. Über den Puls kann man versuchen, Herzfrequenz und -rhythmus zu kontrollieren. Wenn sich in Ruhe keine Normalisierung einstellt, sollte ein Notarzt gerufen und das Kind unmittelbar in ‚seine’ Klinik gebracht werden, damit durch unnötige Zwischenstationen keine Zeitverzögerung entsteht (die Klinik schon vorher telefonisch informieren!)
Kreislaufprobleme
Bei Ohnmacht oder Herzrhythmusstörungen sollten Eltern ihr Kind unverzüglich von einem Notarzt ins Krankenhaus bringen lassen.
Mehr Info: https://bvhk.de/kinderherzen-vor-hitze-schuetzen-sommer-2022/
Quelle: Pressemitteilung Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.