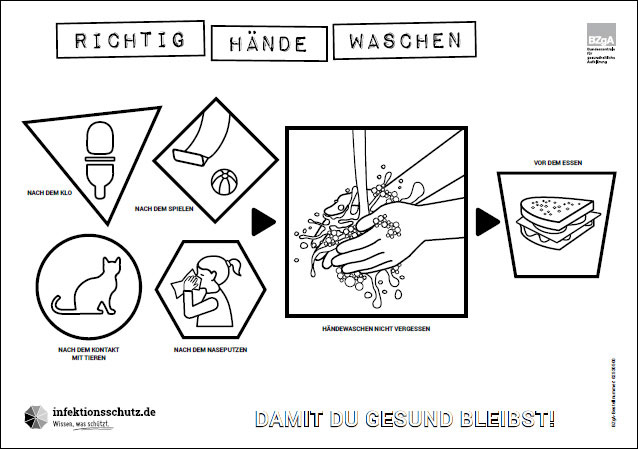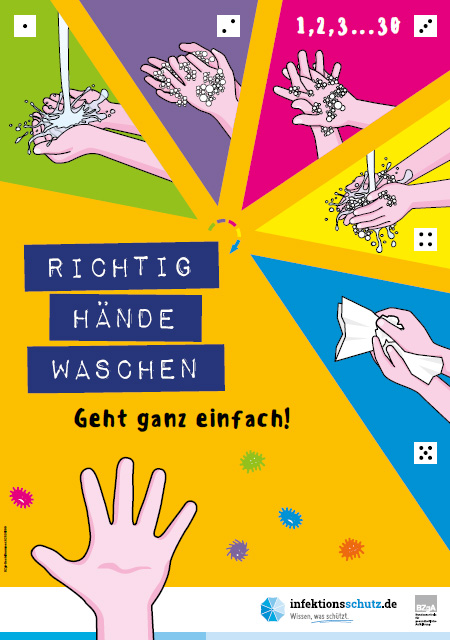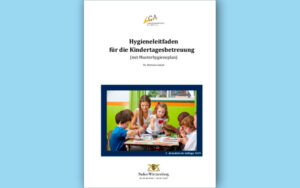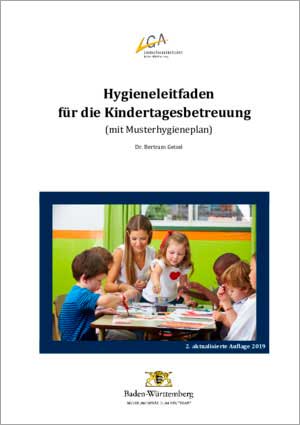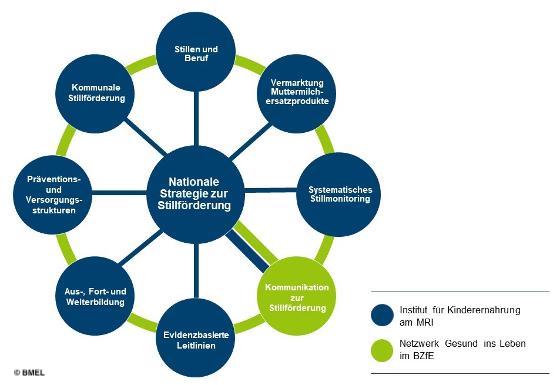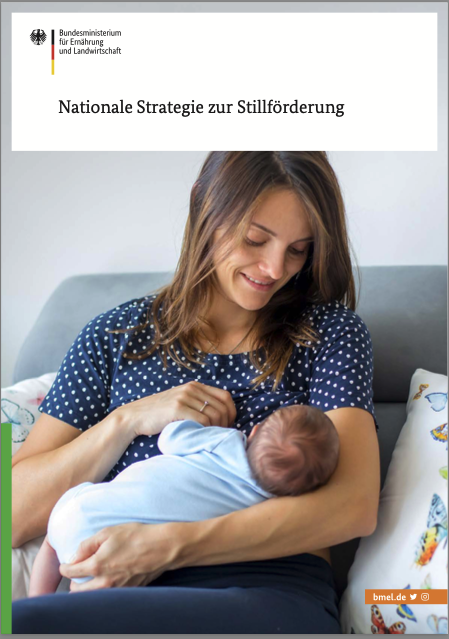Studie zu den Belastungen von Familien während der Pandemie

Weitreichende Folgen für Bildung, Gesundheit, Lebensqualität und Zukunftsperspektiven
Zu Beginn der Corona-Pandemie im Januar 2020 lebten in Deutschland rund 13,7 Mio. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren – das entspricht in etwa einem Sechstel der Gesamtbevölkerung. Besonders betroffen vom Lockdown und seinen Folgen waren Schulkinder unter 12 Jahren (4,4 Mio.), für die teilweise eine Notbetreuung vorgesehen war, sowie weitere 4,5 Mio. Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Kita- und Schulschließungen hatten weitreichende Auswirkungen auf Bildung, Gesundheit, Lebensqualität und Zukunftsperspektiven von Familien. Die Folgen untersucht eine neue BiB-Studie.
Gesundheitliche und entwicklungspsychologische Dimension von hoher Bedeutung
Die gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche sind vielfältig: Es gibt Hinweise auf einen Anstieg von psychischen Beeinträchtigungen von Kindern, insbesondere bei psychosomatischen Beschwerden, Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Erkrankungen, vor allem bei bereits vorbelasteten Kindern. Auch die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung vieler Kinder und Jugendlicher wurde durch die Kontaktbeschränkung beeinträchtigt. Infolge der Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen hat sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei hochgerechnet 1,7 Millionen Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren erheblich verschlechtert.
477.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren mit Depressivitätssymptomatik
Analysen aus dem deutschen Familienpanel pairfam weisen darauf hin, dass nach dem ersten Lockdown (Mai/Juni 2020) etwa 25 Prozent der Jugendlichen auf Basis einer etablierten Skala mit Selbsteinschätzungen eine deutliche Symptomatik von Depressivität aufweisen. Im Jahr vor der Pandemie betraf das lediglich 10 Prozent dieser Altersgruppe. Nach einer Hochrechnung betrifft der Anstieg der Depressivitätssymptomatik rund 477.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren. „Die Auswirkungen von Schulschließungen auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sind offensichtlich gravierender als bisher angenommen. Davon sind jugendliche Mädchen und Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger betroffen“, erklärt Dr. Martin Bujard vom BiB. „Das Offenhalten der Schulen sollte hohe Priorität haben, damit sich psychische Belastung und Lernrückstände nicht noch weiter verstärken können.“
Lernzeit hat sich durch die Schulschließungen deutlich reduziert
Belastungen für Kinder und Jugendliche betreffen die Bildung, die körperliche und psychische Gesundheit sowie die Persönlichkeitsentwicklung. Die Zeit für schulische Aktivitäten hat sich während des ersten Lockdowns halbiert und lag im zweiten Lockdown bei durchschnittlich rund 60 Prozent. Allerdings gibt es hierbei erhebliche Unterschiede innerhalb der Gruppe der Schülerinnen und Schüler: Einige konnten im Distanzunterricht relativ gut lernen, andere sind besonders stark abgehängt. „Bei einigen vulnerablen Kindern können sich Lernrückstände und psychische Beeinträchtigungen wechselseitig verstärken“, meint Bujard. „Bei den Betroffenen ist es hilfreich, Druck von den Schülerinnen und Schülern nehmen. Bildungsdefizite aufzuholen ist ein langfristiger Prozess, viele belastete Kinder müssen zunächst gestärkt werden und unbeschwerte Zeit mit Gleichaltrigen und Lebensfreude erleben.“
Keine „verlorene Generation“
Angesichts der Zahlen sei es jedoch nicht gerechtfertigt, pauschal von einer ‚verlorenen Generation‘ zu sprechen, findet Dr. Martin Bujard: „Rund zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen sind trotz mancher Schwierigkeiten relativ gut durch die bisherigen pandemiebedingten Einschränkungen gekommen. Es ist zu erwarten, dass sie in dieser Phase auch Kompetenzen hinsichtlich Digitalisierung und Selbständigkeit erworben haben.“ Allerdings ist eine differenzierte Sicht notwendig: Belastete Kinder und Jugendliche gibt es in allen Bevölkerungsgruppen, sie finden sich jedoch in einigen soziodemografischen Gruppen deutlich häufiger.
Soziale Ungleichheiten verstärken die Belastung von Familien
Die Schließung von Bildungseinrichtungen aufgrund der Pandemie hat viele Kinder und Jugendliche vor erhebliche Hürden gestellt: „Im Lockdown entfällt Schule als ein mit Lernen assoziierter Ort, der einen festen Rhythmus von Lern- und Erholungszeiten vorgibt, was Folgen für die Lernmotivation, Lernzeiten und Lernerfolg hat“, erklärt die Soziologin Kerstin Ruckdeschel vom BiB. Vor allem Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien oder diejenigen, die zuhause kein Deutsch sprechen, sind durch Schulschließungen besonders benachteiligt. So haben etwa 11 Prozent der schulpflichtigen Kinder Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss. Bei etwa jedem siebten Schulkind (ca. 1,0 Mio.) wird zuhause überwiegend kein Deutsch gesprochen. Hinzu kommt, dass bei Kontaktbeschränkungen die eigene Wohnsituation entscheidend ist: Gerade in Großstädten leben viele Familien in beengten Verhältnissen – etwa jede vierte Familie mit zwei Kindern lebt in Wohnungen mit weniger als 80 Quadratmetern Fläche. Da die meisten Familien in Mehrfamilienhäusern leben, hat etwa ein Drittel von ihnen keine Gartennutzung.
Große Herausforderung für berufstätige Eltern
Während der coronabedingten Schließungen fühlten sich die Menschen unterschiedlich stark belastet. Bereits im ersten Lockdown zeigte sich, dass dieser für manche Bevölkerungsgruppen (beispielsweise Paare ohne Kinder) auch eine Art Entschleunigung darstellte – bei ihnen sank der wahrgenommene Stress. Dagegen standen viele Eltern besonders im Bereich der Kinderbetreuung und des Homeschooling durch die Schließungen von Kitas und Schulen vor großen Herausforderungen. „Bei Paaren mit jüngeren Kindern unter 10 Jahren hat sich das subjektive Stressempfinden nicht verändert, sondern blieb auf einem vergleichsweisen hohen Niveau“, ergänzt Kerstin Ruckdeschel vom BiB. Der Zeitbedarf wurde von Vätern und Müttern je nach beruflicher Situation unterschiedlich aufgefangen. Viele Väter haben sich in der Familie zusätzlich engagiert, dadurch hat sich im ersten Lockdown der durchschnittliche Anteil der Familienarbeit der Väter erhöht. Mütter jedoch übernahmen nach wie vor den Hauptteil der Familienarbeit. Dies betrifft sowohl die Zeitverwendung als auch die kognitive Planungsarbeit, den sogenannten ‚Mental Load‘.
Wechselseitige Beziehungen zwischen Kindern und Eltern
Die Belastungen durch Schul- und Kita-Schließungen haben sich auf verschiedene Aspekte des Wohlbefindens der Eltern, beispielsweise auf die Lebenszufriedenheit und die emotionale Erschöpfung negativ ausgewirkt. Insbesondere Mütter, Alleinerziehende und Familien mit niedrigem Einkommen waren besonders betroffen, die schon vor der Pandemie einer hohen Belastung ausgesetzt waren. Aber auch hierbei gab es Rückkopplungen zu den Kindern, wie Kerstin Ruckdeschel erklärt: „Viele Studien zeigen übereinstimmend, dass die Belastungen von Eltern auch das Wohlbefinden der Kinder beeinflussen. Die Unterstützung von Kindern bedeutet deshalb immer auch eine Hilfe für die Eltern – und umgekehrt.“
Quelle: Pressemitteilung BiB