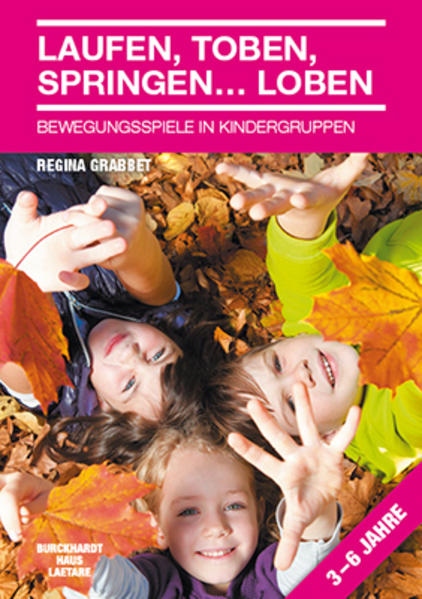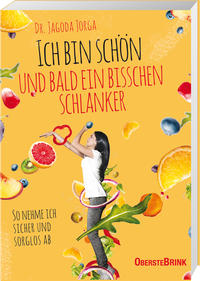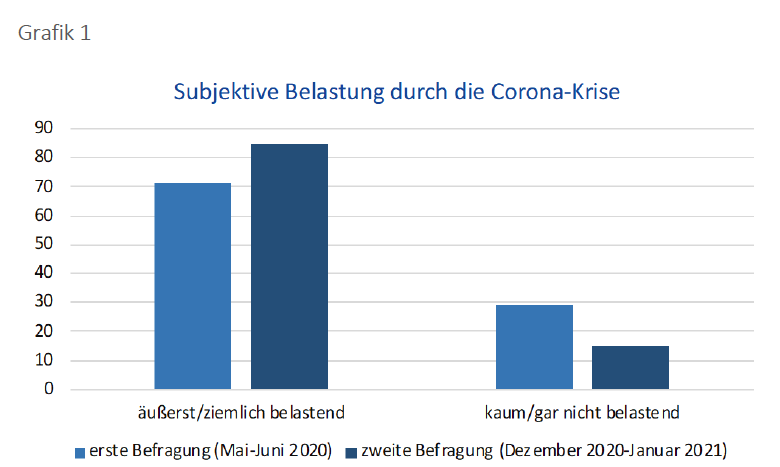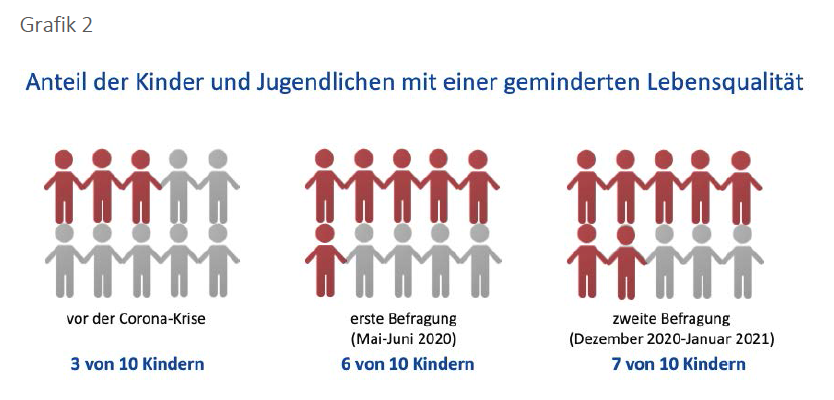Wie Kinder durch Bewegung lernen
Vieles hat die Kindheit in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Zu diesen Veränderungen rechnen die meisten Menschen die Digitalisierung mit Tablets, Smartphones oder Spielkosolen. Viel zu wenige haben dagegen bemerkt, wie die freien Bewegungsräume für Kinder geschwunden sind. Dabei ist Bewegung für die physische Entwicklung genauso wichtig, wie für die kognitive. Darüber schreibt Regina Grabbet im folgenden Beitrag. Er stammt aus Ihrem wunderbaren Buch „Laufen, toben, springen… loben“.
Von unterschiedlichen Anlagen und vorhandenen Födermöglichkeiten
Kinder vervollkommnen ihre vielfältigen Bewegungsformen vom dritten bis siebten Lebensjahr. In dieser Zeit eignen Sie sich auch erste Bewegungskombinationen an. Dabei müssen wir die Entwicklung der Motorik als Prozess fortschreitender Veränderung begreifen. Der Entwicklungsstand eines Kindes sollte zwar in etwa einem Vergleich mit anderen Kindern standhalten, zu berücksichtigen sind aber immer die individuell doch oft unterschiedlichen Anlagen und vorhandenen Fördermöglichkeiten.
- Jedes Kind ist auch in seiner Entwicklung als Individuum zu begreifen. Leistungsvergleiche und Leistungsdruck sind schädlich und verunsichern.
- In den vergangenen Jahren haben die Haltungsschäden bei Kindern zugenommen. In der Entwicklungsbegleitung von Kindern sollte man versuchen, darauf zu achten, dass sie bei ihren Aktivitäten nicht einseitig grobmotorisch belastet werden. Angebote, die eine gute Haltung unterstützen, sind sinnvoll.
- Maßgebend für eine positive motorische Entwicklung ist die sensorische Integration.
Sensorische Integration
Diesen Begriff möchte ich etwas ausführlicher erklären: Jeder Mensch lernt von Geburt an, Empfindungen, die er wahrnimmt, einzuordnen, um sie gebrauchen zu können. Dies ist die Integration der Sinne. Unsere Sinne geben uns verschiedene Informationen, etwa über den physikalischen Zustand unseres Körpers. Sie geben uns aber auch Informationen über unsere Umwelt. Laufend erreichen uns neue Signale, die wir sinnlich wahrnehmen.
Diese verschiedenartigen Empfindungen werden vom Gehirn geordnet – damit wir uns etwa normal bewegen lernen. Erst wenn diese gespeicherten Empfindungen geordnet und in der nötigen Reihenfolge abgerufen werden können, können sie auch zielgerecht genutzt werden, um Lernprozesse in Gang zu setzen und gewünschtes Verhalten zu verinnerlichen.
Bewegung für das Gehirn
Verhaltenschaos entsteht dagegen bei unorganisierten Empfindungen. Das Kind muss in diesem Fall seine Sicherheit neu gewinnen. Sensorische Integration ist also sinnliche Verarbeitung von Wahrnehmungen ganz verschiedener Art. Bei der Integration werden Empfindungen in Wahrnehmungen überführt und etwa als Verhaltensanleitung gespeichert. So muss ein Kind sehr viel an sensorischer Integration aufbringen, um die ersten Bewegungen auszuführen. Es ist dabei für uns Erwachsene wichtig zu wissen, dass das Gehirn bis zum Alter von sieben Jahren vorwiegend eine Verarbeitungs- und Speicherfunktion für sinnliche Wahrnehmungen darstellt. Das Kind sammelt seine Erfahrungen weitgehend über die Gefühle und Empfindungen.
Der Körper reagiert in Beziehung zu diesen Empfindungen, die Reaktionen gehen eher von den Muskeln als vom Verstand aus. Sie sind eher motorisch als geistig konzipiert. Die ersten sieben Jahre sind also Jahre der sensomotorischen Entwicklung.
Auch wenn später geistige und soziale Reaktionen diese sensomotorischen Impulse ersetzen, so ist die sensorische Integration, die etwa in der Bewegung Ausdruck findet, die Grundlage für die komplexere sensorische Integration, die nötig ist für intellektuelles und soziales Verhalten.
Laufen und Springen fördern die Intelligenz
Ermöglichen wir dem Kind in den ersten sieben Jahren vielfältige Erfahrungen in diesem Bereich, so wird es später in intellektuellen und komplizierteren motorischen Abläufen leichter lernen können, weil es über eine gute Grundsicherheit verfügt. Kinder möchten sich bewegen; das Erlebnis der Bewegungen stimuliert ihr Gehirn. Toben, Hüpfen, Laufen und Springen, all diese körperlichen Empfindungen fördern die Intelligenz und das Selbstbewusstsein. Das Kind wächst mit seinen Aufgaben. Geben wir ihm welche. Aber ohne Druck!
Es gibt sehr viele motorisch unruhige und gehemmte Kinder. Die Ursachen dafür sind oft in der Bewegungsarmut zu finden. Traut man Kindern nicht viel zu, werden sie in ihrem Bewegungsdrang eingeschränkt, so werden sie schließlich leicht verstört, verkrampfen sich, verlieren an Selbstvertrauen – werden auffällig.
Reizüberflutung
Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen. Kinderärzte haben festgestellt, dass man Kindern zu wenig Bewegungsfreiräume lässt, außerdem spielt die Reizüberflutung beim Medienkonsum eine große Rolle.
Kinder müssen viel sitzen und bekommen selten die Möglichkeit sich auszutoben. Die Erwachsenen sind schnell durch unruhige ADS-Kinder genervt. Statt notwendige Bewegungsaktionen möglich zu machen, werden den Kindern schnell Ritalin oder ähnliche Beruhigungsstoffe verabreicht. Dadurch werden die Kinder chemisch ruhiggestellt und die Erwachsenen sind wieder zufrieden.
Hirnforscher warnen in neusten wissenschaftlichen Untersuchungen vor der passiven Aktivität der Kinder mit Computern, da im Kontakt mit dem Computer die sinnliche Erfahrung fehlt. Dadurch findet Lernen einseitig statt. Das selbstständige Denken kommt zu kurz, die Hirnsynapsen verkümmern. In seinem Buch, „die digitale Demenz“ weist der bekannte Hirnforscher Manfred Spitzer auf diese Gefahren hin. Sein Kollege Gerald Hüter berichtet von Beispielen emotionaler Defizite durch passiven Medienkonsum. Die Hirnforschung warnt vor passivem Kopflernen und empfiehlt Bewegungseinheiten zwischen den Lernphasen oder während der Lernphasen!
Kinder müssen in der Familie, im Kindergarten oder in der Schule häufig stillsitzen, nehmen passiv auf und lernen, indem sie das Gesagte geistig verarbeiten. Wir beobachten oft, dass Kinder, die in der Schule zu geistigen Höchstleistungen in der Lage sind, Bewegungsstörungen aufweisen. Eltern machen oft den Fehler, dass sie Geist und Körper nicht als Ganzes, eine Einheit begreifen. Sie richten ihr Augenmerk überwiegend auf die Leistungen im geistigen Bereich und versuchen diese entsprechend dem Leistungsideal unserer Gesellschaft zu verstärken.
Überforderung statt Bewegungsfreiraum
Der Leistungsdruck der Kinder ist enorm gestiegen, die Kinder müssen viel intellektuelle Kopfarbeit leisten und sind damit oft überfordert. Im Kindergarten werden Erzieher/innen von den Eltern oft danach befragt, ob sie auch Vorschulübungen anbieten, ob die Kinder im intellektuellen Bereich gefördert und auf die Schule vorbereitet werden. Selten wird dagegen nach der Entwicklung im motorischen Bereich gefragt, also ob das Kind genügend Bewegungsfreiräume hat, ob es sich etwas zutraut. Bildung findet in verschiedenen Bereichen statt und nicht nur durch eine „Vorschulübungsmappe“. Kinder lernen spielerisch und durch Bewegung. Sie erleben, erforschen, entdecken und gestalten. Diese Aktivitäten finden nicht nur im Kopf statt, sondern auch durch Körpererfahrungen.
Körper und Psyche im Einklang
Interesse zeigen Eltern erst dann, wenn Kinder im Sport Höchstleistungen erbringen. Die ganz normale Bewegungsförderung des Körpers, dem Bewegungsdrang der Kinder mit Anregungen entgegenzukommen, das haben Erwachsene verlernt oder sehen es nicht als für ihr Kind wichtig an. Der Grund ist vielleicht, dass sie selbst ihre Bewegungsstörungen, ihre Bewegungsarmut nicht mehr wahrnehmen. Sie
haben es verlernt oder nie gelernt, Körper und Psyche in Einklang zu bringen, ihren Gefühlen und Stimmungen durch Bewegung Ausdruck zu verleihen.
Warum laufen wir nicht einfach los, wenn uns danach ist, statt gesittet auf dem Gehweg zu schreiten? Warum springen wir nicht einfach in die Luft, wenn wir uns freuen, statt nur zu lächeln und die Freude durch Sprache auszudrücken? Sind wir nicht auch schon bewegungsgestört? Wir kompensieren Frust durch Konsum, der in der Regel wenig Bewegungsaktivität erfordert.
Toben bringt gute Laune
Um das Bewegungsverhalten und Bedürfnis unserer Kinder zu verstehen, müssen wir aber auch unser eigenes Verhalten in diesem Bereich kritisch überprüfen und möglichst einer Veränderung unterziehen; es lohnt sich.
Tobespiele machen Spaß. So habe ich in der Arbeit auf Seminaren mit Kindern und Erwachsenen festgestellt, dass Erwachsene solchen Spielen erst sehr ablehnend gegenüber standen, nach einer Gewöhnungsphase aber viel Spaß daran hatten. Gerade beim Toben wird viel gelacht. Je wilder das Spiel, je mehr Bewegung im Spiel ist, umso lustiger wird die Stimmung. Auch in diesem Sinn hat Bewegung etwas mit psychischer Verfassung zu tun. Warum sehen wir meist die Familien gesittet und gemächlich bei ihrem Sonntagsspaziergang die Parks abschreiten? Warum veranstalten sie nicht mal wilde Tobespiele miteinander? Weil sich das nicht gehört? Sie würden mit Sicherheit in einer ausgelasseneren Stimmung den Heimweg antreten.
Bewegungsspiele können ermüdete und verspannte Menschen, Frustrierte und Ängstliche, Langsame und Verkrampfte, Unsportliche und Gehemmte wieder in bessere Form und gute Laune bringen.
Diesen Artikel haben wir aus Regina Grabbets Buch mit dem Titel „Laufen, Toben, Springen … Loben“ entnommen. Das Buch ist bei Burckhardthaus-Laetare erschienen.