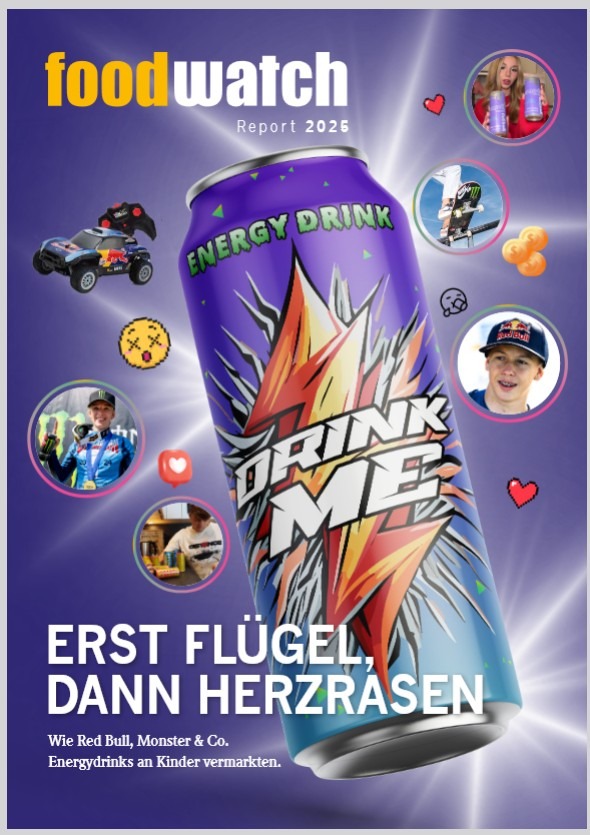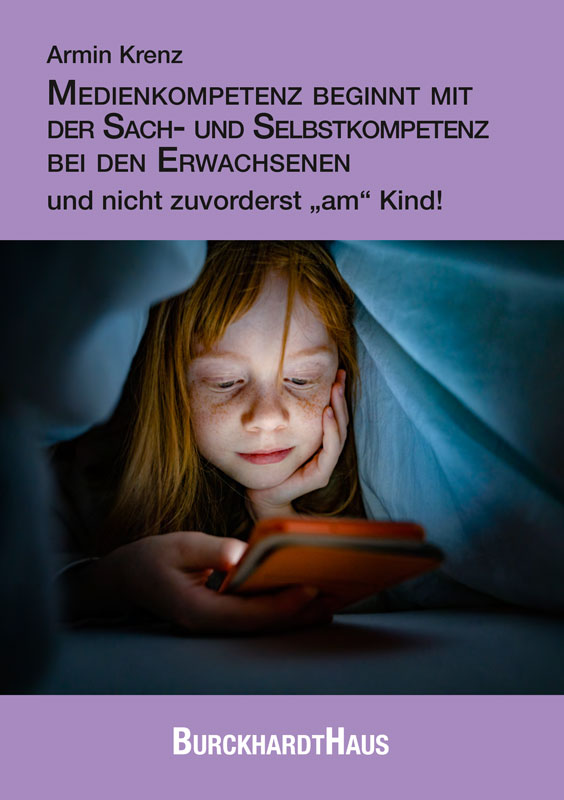Neue Untersuchungen bestätigen Zusammenhang zwischen Weichmachern in Kinderurin und Verwendung von Sonnenschutzmitteln
Aktuelle Untersuchungsergebnisse des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) sowie der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUÄ) in Nordrhein-Westfalen bestätigen den Zusammenhang, dass der Weichmacher DnHexP (Di-n-hexyl-Phthalat) aus Verunreinigungen im UV-Filter DHHB (Diethylamino-hydroxybenzoyl-hexyl-benzoat) in Sonnenschutzmitteln stammt.
Bisher untersuchte Sonnenschutzmittel wiesen teilweise Verunreinigungen mit dem Weichmacher DnHexP auf. Dies zeigt sich auch in den Kinderurin-Untersuchungen des LANUV. Die Belastungen liegen jedoch für über 99 Prozent der 250 untersuchten Kinder unterhalb der Schwelle für eine gesundheitliche Besorgnis. Somit ist die Verwendung von Sonnenschutzmitteln in der Regel sicher. Aus Gründen der Vorsorge muss aber sichergestellt sein, dass Sonnenschutzmittel nicht mit DnHexP verunreinigt sind.
Sonnenschutzmittel könnten auch frei von Weichmachern sein
Die nordrhein-westfälischen Behörden haben außerdem zusammen mit Kosmetikherstellern, vertreten durch die Fachverbände, herausgefunden, dass es möglich ist, Sonnenschutzmittel so herzustellen, dass der UV-Filter DHHB frei von Verunreinigungen ist. Deshalb wurden Hersteller dazu aufgefordert, vorsorglich ihre Produktion so umzustellen, dass keine schädlichen Weichmacher mehr messbar sind.
Alle Bewertungen sind weiterhin vorläufig, da die bundesweit laufende Ursachenforschung noch nicht abgeschlossen ist. Im laufenden Jahr soll es ein neues bundesweites Monitoring geben, um einen neuen Orientierungswert für die technische Vermeidbarkeit von DnHexP im UV-Filter DHHB abzuleiten.
Ergebnisse der Kinderurin-Untersuchungen des LANUV (KiSA-Studie)
Das LANUV untersucht regelmäßig im Auftrag des Umweltministeriums Nordrhein-Westfalen den Urin von 250 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren auf verschiedene Schadstoffe wie Weichmacher, Pestizide oder Konservierungsmittel. Im Januar 2024 hatte das Landesamt erstmals Mono-n-hexyl-Phthalat (MnHexP), ein Stoffwechselabbauprodukt des Weichmachers DnHexP, im Kinderurin gefunden. Der Weichmacher DnHexP darf seit 2019 nicht mehr in kosmetischen Mitteln enthalten sein, weil er im Verdacht steht, die Fruchtbarkeit zu schädigen. In einer früheren Auswertung des LANUV vom März 2024 konnte bereits gezeigt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von Sonnencreme und erhöhten MnHexP-Belastungen im Urin der Kinder gibt.
Das LANUV hat daraufhin im Jahr 2024 zwei weitere Nachweisverfahren geführt, die zum einen bei einer erneuten Kontrolle ähnlich auffällige Werte ergaben: In weiteren 250 Kinderurinproben von 2023/2024 wurde bei 55 Prozent der Proben MnHexP nachgewiesen. Bei zwei Proben wurden MnHexP-Konzentrationen gemessen, die oberhalb des von der Kommission Human-Biomonitoring im März 2024 abgeleiteten gesundheitlichen Beurteilungswertes (HBM-I-Wert) von 60 Mikrogramm pro Liter lagen. Dieser HBM-I-Wert stellt einen Vorsorgewert für die Allgemeinbevölkerung dar. Bei einer Überschreitung sollte der Messwert kontrolliert, nach Quellen für die Belastung gesucht und diese minimiert werden.
„Untersuchungsergebnisse bestätigen die Herkunft der Weichmacher aus Sonnenschutzmitteln“
Zum anderen hat das Landesamt in Zusammenarbeit mit den für den gesundheitlichen Verbraucherschutz zuständigen Behörden und Wirtschaftsbeteiligten Sonnenschutzmittel als mögliche Quelle identifiziert.
„Die neuen Untersuchungsergebnisse bestätigen den Zusammenhang, dass der Weichmacher aus dem verunreinigten UV-A-Filter DHHB in Sonnenschutzmitteln stammt“, erklärt Elke Reichert, Präsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. „Wir haben in dieser Studienreihe nicht nur auf eine Belastung mit dem Weichmachermetaboliten geschaut. Wir haben in den Urinproben der Kinder auch nach Stoffwechselprodukten des verunreinigten UV-Filters gesucht. Unsere Ergebnisse bestätigen für einen Großteil der Proben den Zusammenhang zwischen dem Weichmacher und dem kontaminierten UV-Filter.“
Hinweise auf mögliche Umweltbelastungen durch LANUV
„Damit tragen die Ergebnisse des Landesumweltamtes NRW wesentlich zur Aufklärung dieser bundesweiten Problematik bei. Die KISA-Studie des LANUV ist wichtig, um frühzeitig Hinweise auf mögliche Umweltbelastungen zu erhalten und gegensteuern zu können. Je mehr Transparenz und Aufklärung wir schaffen, desto mehr Schutz resultiert daraus am Ende für uns alle“, erklärt Umweltminister Oliver Krischer.
Die Ergebnisse des LANUV zeigen auch, dass mindestens ein Drittel der Kinder Abbauprodukte des UV-Filters aufwiesen, ohne dass der Weichmachermetabolit bei ihnen nachgewiesen wurde. Dies bestätigt, dass die Herstellung von UV-Filtern ohne DnHexP-Verunreinigung möglich ist und dass DnHexP-freie Sonnenschutzprodukte am Markt verfügbar sind.
Ergebnisse der Untersuchungen von Sonnenschutzmitteln durch die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter
Seit Anfang 2024 werden in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern verstärkt Untersuchungen von Sonnenschutzmitteln und von sog. UV-A-Filtern durchgeführt. Die CVUÄ in Nordrhein-Westfalen, die für kosmetische Mittel zuständig sind, untersuchten 42 Sonnenschutzmittel.
Die Ergebnisse zeigen, dass die gemäß EU-Kosmetikverordnung festgelegte maximale Einsatzkonzentration von zehn Prozent des UV-A-Filters DHHB in kosmetischen Mitteln bei keinem der untersuchten Produkte überschritten wurde. In 31 (74 Prozent) untersuchten Produkten wurden DHHB-Gehalte nachgewiesen, in elf Sonnenschutzmitteln war kein DHHB nachweisbar. Bei sechs Sonnenschutzmitteln (14 Prozent) wurden DnHexP-Gehalte zwischen 0,8 und 5,9 mg/kg bestimmt. Bei 86 Prozent war kein DnHexP nachweisbar. Die in Nordrhein-Westfalen ermittelten Analyseergebnisse decken sich mit denen anderer Bundesländer.
Gesundheitliche Beeinträchtigung sehr unwahrscheinlich
Neben Sonnenschutzmitteln selbst wurden auch weitere zwölf Proben des Rohstoffes DHHB (UV-A-Filter) analysiert. In allen Proben war DnHexP nachweisbar. Bei zehn Proben lagen die Gehalte zwischen 9,9 bis 69,7 mg/kg; zwei Proben wiesen Gehalte von über 100 mg/kg auf. Die ermittelten Analysenergebnisse zeigen, dass sich die DnHexP-Gehalte im Rohstoff unterscheiden können.
Das Bundesamt für Risikobewertung geht davon aus, dass selbst bei höheren Verunreinigungen ein hinreichender Sicherheitsabstand besteht und eine gesundheitliche Beeinträchtigung daher sehr unwahrscheinlich ist.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten die Ergebnisse, dass die auf dem Markt bereitgestellten Sonnenschutzmittel sicher sind und dass es auch Sonnenschutzmittel mit DHHB ohne nachweisbare Verunreinigung mit DnHexP gibt.
Das Verbraucherschutzministerium Nordrhein-Westfalen schließt sich weiterhin allgemein der geltenden Empfehlung an, dass Verbraucherinnen und Verbrauchern keinesfalls auf Sonnenschutzmittel verzichten sollen, denn UV-Strahlung ist nach wie vor die Hauptursache für die Entstehung von Hautkrebs.
Umfangreiches Maßnahmenpaket eingeleitet
Aufgrund der Zusammenhänge haben die zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden und die Wirtschaftsbeteiligten Maßnahmen zur weiteren Minimierung der Verunreinigungen eingeleitet.
- Zentral wird dabei die Herstellung von DHHB so umgestellt, dass das Vorkommen von Verunreinigungen auf ein technisch machbares Minimum reduziert wird.
- Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen wird von den Lebensmittelüberwachungsbehörden kontrolliert.
- Beim bundesweiten Monitoring 2025 soll ein analytisch ermittelter Orientierungswert für die technische Vermeidbarkeit von DnHexP im UV-A-Filter DHHB abgeleitet werden.
- Auf EU-Ebene hat der wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS) den Auftrag erhalten, die Reinheit des UV-Filters in Sonnenschutzmittel neu zu bewerten.
- Um die Bewertungsprozesse zu unterstützen, werden das nordrhein-westfälische Umweltministerium und das Verbraucherschutzministerium die aktuellen Untersuchungsergebnisse einspeisen.
- Das LANUV setzt die regelmäßigen Untersuchungen von Kinderurin auf MnHexP im Rahmen der LANUV-KiSA-Studie fort.
Viele Phthalate sind für die Gesundheit des Menschen schädlich
Weichmacher gehören zu den vom LANUV untersuchten Stoffen. Eine wichtige Weichmacher-Gruppe sind die Phthalate. Diese Stoffe werden im Körper des Menschen in sogenannte Metaboliten umgewandelt und mit dem Urin ausgeschieden. Viele Phthalate sind für die Gesundheit des Menschen schädlich, da sie Effekte auf das Fortpflanzungssystem haben. Für eine Reihe von Phthalaten bestehen deshalb umfangreiche Verwendungsbeschränkungen. Vom LANUV werden aktuell insgesamt 35 Phthalat-Metaboliten im Urin von Kindern untersucht.
Allen an der Studie teilnehmenden Erziehungsberechtigten bietet das LANUV eine umfassende umweltmedizinische Beratung zu den ermittelten Ergebnissen an. Kinder mit Überschreitungen können eine Nachuntersuchung erhalten. Außerdem bietet das LANUV den Erziehungsberechtigten an, nach den möglichen Quellen für die erhöhte Belastung zu suchen.
Die Schadstoffbelastung von Kindern wird regelmäßig untersucht
Das LANUV untersucht regelmäßig im Auftrag des NRW-Umweltministeriums die Schadstoffbelastung von Kindern aus Nordrhein-Westfalen (KiSA-Studie NRW). Alle drei Jahre wird seit 2011 der Urin von jeweils 250 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren auf verschiedene Schadstoffe wie Weichmacher, Pestizide oder Konservierungsmittel analysiert. Der nächste reguläre Durchgang erfolgt in den Jahren 2026/27. Solche Untersuchungen wie die KiSA-Studie NRW werden als Human-Biomonitoring bezeichnet. Mit den LANUV-Daten aus dem Human-Biomonitoring lassen sich zeitliche Veränderungen in der Schadstoffbelastung der Kinder aufzeigen. Sie dienen als Frühwarnsystem für das Erkennen von Belastungen mit Schadstoffen.
Informationen zur Studie des LANUV:
https://www.lanuv.nrw.de/themen/umwelt-und-gesundheit/umweltmedizin/umweltepidemiologie/schadstoffe-im-urin-von-kindern-bestimmung-von-schadstoffen-im-urin-von-kindern-aus-nrw
Pressemitteilung Landesregierung Nordrhein-Westfalen