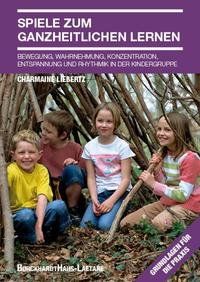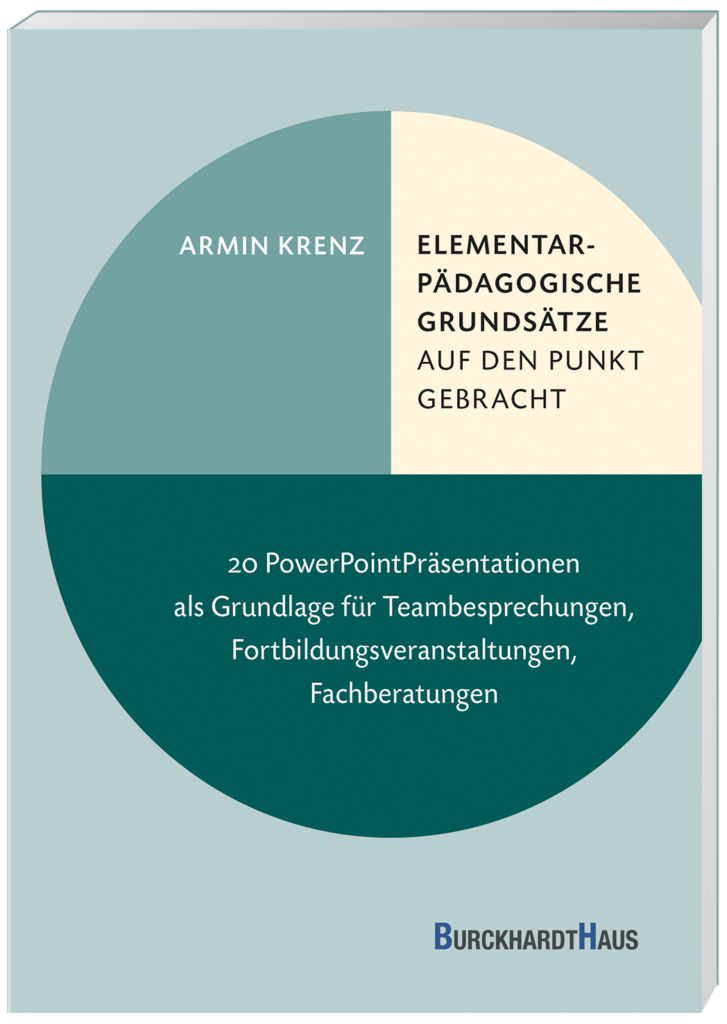Warum Eltern ihren Babys vorsingen sollten

Spiellieder prägen die Sprachfähigkeiten von Kleinkindern
Eltern singen ihren Babys oft Wiegenlieder oder fröhliche Spiellieder vor. Doch wie reagieren Babys auf diese alltäglichen Gesänge – und welche Rolle spielen sie für die kindliche Entwicklung? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam der Universität Wien in Zusammenarbeit mit der University of East London in einer aktuellen Studie nachgegangen. Das Fazit: Welche Lieder Eltern mit ihren Kleinen singen und wie Babys auf unterschiedliche Rhythmen reagieren, hängt mit der späteren Sprachentwicklung der Kinder zusammen. Die Studie erscheint aktuell im Fachjournal Developmental Cognitive Neuroscience.
Vom Instinkt zur bewussten Aktion
Musik spielt eine tiefgreifende Rolle im menschlichen Alltag – und das schon von ganz früh. Weltweit singen Eltern instinktiv für ihre Babys in vielerlei alltäglichen Situationen, etwa beim Wickeln oder Spielen. Dabei wollen sie ihre Kleinen beruhigen, deren Aufmerksamkeit gewinnen oder einfach gemeinsam Spaß haben. Forscherinnen und Forscher aus dem Wiener Kinderstudien Labor der Universität Wien haben sich nun gefragt, wie junge Säuglinge auf unterschiedliche, von der Mutter vorgesungene Rhythmen reagieren und welche Folgen die Wahrnehmung und Verarbeitung dieser Rhythmen für die Sprachentwicklung hat.
Musik motiviert
Die akustischen Merkmale von Kinderliedern variieren abhängig von ihrem Verwendungszweck: Spiellieder zeichnen sich durch eine höhere Rhythmik, ein schnelleres Tempo und höhere Tonhöhen aus. Sie sind zudem musikalisch vielfältiger und komplexer als Schlaflieder. Letztere sind durch ein langsames Tempo, tiefere Tonhöhen und weniger musikalische Variation gekennzeichnet, um Babys zu beruhigen und beim Einschlafen zu helfen. In einer neuen Studie haben Mütter ihren sieben Monate alten Babys zwei bekannte Kinderlieder vorgesungen – ein Schlaflied („Schlaf, Kindlein schlaf“) und ein Spiellied („Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“).
Bei den Säuglingen wurde dabei die Gehirnaktivität mittels Elektroenzephalographie (EEG) gemessen. Zusätzlich wurden die rhythmischen Bewegungen (etwa wippen oder strampeln) der Babys beobachtet. Als diese Kinder 20 Monate alt waren, wurden die Eltern mittels Fragebogen über den Wortschatz ihrer Kleinkinder befragt.
Schlaflieder und Spiellieder
Durch moderne Analyseverfahren konnten die Forscherinnen und Forscher zeigen, dass es möglich ist, anhand der Gehirnaktivität der Babys die neurale Verarbeitung beider Arten von Liedern zu beobachten. Dazu Studienerstautorin Trinh Nguyen: „Unsere Ergebnisse zeigten, dass es den Babys leichter fiel, das Schlaflied mit ihrer Gehirnaktivität zu ,tracken’“. Damit ist gemeint, dass die Gehirnwellen den Klang des Gesangs widerspiegeln. Das liegt wahrscheinlich am langsamen Tempo und den einfachen Strukturen des Liedes.
Mehr rhythmische Bewegungen zeigten die Säuglinge allerdings während des Spiellieds.“ Die etwas komplexeren musikalischen Strukturen der Spiellieder könnten anregender sein und die Kinder dadurch motivieren, sich mehr zur Musik zu bewegen. Spannenderweise wirkte sich aber nur das neuronale Tracking in Kombination mit rhythmischen Bewegungen beim Spiellied positiv auf die Größe des Wortschatzes der Kinder im Alter von 20 Monaten aus.
Auf das Lied kommt es an
Die Studie legt nahe, dass die Art und Weise, wie Babys auf unterschiedliche Lieder reagieren, mit ihrer späteren sprachlichen Entwicklung zusammenhängen könnte. Dies eröffnet Möglichkeiten für weitere vertiefende Forschung, um die Mechanismen und genauen Zusammenhänge zwischen musikalischer Wahrnehmung und Sprachentwicklung besser zu verstehen. In weiterführenden Studien untersucht das Forschungsteam zum Beispiel, welche musikalischen Elemente (Tonhöhe, Tempo, Klangfarbe) für Babys besonders anregend sind.
Die Erkenntnisse könnten für die Entwicklung von Interventionsprogrammen hilfreich sein, die die musikalische Interaktion zwischen Eltern und Babys gezielt fördern. Dies könnte von der Frühförderung bis zum Kindergarten und darüber hinaus reichen, um die kognitive und sprachliche Entwicklung von Kindern zu unterstützen.
Originalpublikation:
Trinh Nguyen, Susanne Reisner, Anja Lueger, Sam V. Wass, Stefanie Höhl, & Gabriela Markova: Sing to me, baby: Infants show neural tracking and rhythmic movements to live and dynamic maternal singing. In: Developmental Cognitive Neuroscience, 2023.
DOI: 10.1016/j.dcn.2023.101313
Theresa Bittermann, Universität Wien