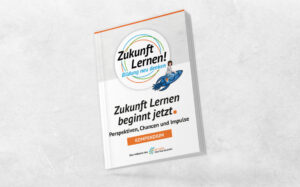Kompendium vom Netzwerk Digitale Bildung als PDF-Version inklusive Hörbuch kostenlos bestellen
Bildung legt die Basis für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung sowie soziale Teilhabe. Unsere gesamte Lebens- und Arbeitswelt ist von der Digitalisierung beeinflusst. Damit wir weiterhin als mündige, kreative Bürgerinnen und Bürger die Gesellschaft in allen ihren Dimensionen mitgestalten können, ist digitale Bildung wichtig.
Wie künftige Generationen auf die digitale Welt vorbereitet werden, bestimmen Schulleitungen und Lehrkräfte, aber auch Schulträger und Bürgermeister vom ersten Schultag an mit. Das Netzwerk Digitale Bildung, das von Unternehmen aus der Wirtschaft getragen wird, hat deshalb ein Kompendium mit dem Titel „ZukunftLernen! Bildung neu denken.“ herausgebracht. Sie finden das Kompendium mit Ideen, Impulsen und praktischen Tipps für die Zukunft des Lernens und Lehrens hier:
Zum Kompendium
Das Kompendium ist aus dem größten Bildungskongress im deutschsprachigen Raum entstanden, den das Netzwerk Ende vergangenen Jahres online veranstaltet hat.
Zukunft der Bildung, Zukunft der Schule, Zukunft des Lernens
Autorinnen und Autoren sind Teilnehmende des Kongresses, unter anderem schreiben Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Dr. Volker Titel, wissenschaftlicher Leiter der Akademie für Ganztagsschulpädagogik, Ulrike Gießner-Bogner, Leiterin der Kulturvermittlung mit Schulen aus Österreich, Ottmar Misoph, Schulleiter a.D., Martin Breier von SMART Technologies, Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Alexander Handschuh, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Hermann Morgenbesser, Koordinator des Future Lerning Lab Wien, und Philipp Raulf, Mitglied des Landtags Niedersachsen. Der Ansatz des Netzwerkes Digitale Bildung ist immer eine heterogene Diskussion mit bereicherndem Austausch. Die Expertencommunity und Förderpartner tragen die Ansätze weiter.
Das neue Kompendium behandelt zehn unterschiedliche Themengebiete mit vielen konkreten Tipps und Links. Unter anderem geht es darum, wie sich der Lernraum Schule verändern muss, wenn wir ein konzentriertes, motiviertes und selbstständiges Lernen und Lehren über den Schulvormittag hinweg erwarten und wenn wir im Hinblick auf die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern die Belastungen reduzieren wollen. Daraus folgt zwingend eine Lernatmosphäre zu schaffen, die das ermöglicht.
Eine Perspektive ist der ebenfalls erwähnte kollaborative Klassenraum als Lernumgebung der Zukunft. Kollaboratives Lernen – also lernen in Zusammenarbeit – heißt: Lernen mit verteilten Aufgaben, gemeinsame Projekte, Austausch und Nutzung verschiedener Medien, begleitet im Prozess von der Lehrkraft. Dazu passt der Abschnitt „In der Ausstattung auf Standards einlassen“. Wenn eine Schule bereits ein pädagogisches Konzept und einen Medienentwicklungsplan hat, muss die passende Technik ausgesucht und angeschafft werden. Dabei gilt als oberstes Gebot: Die Technik folgt der Pädagogik.
Digitale Bildung ist gelebte digitale Transformation
Für diese Zukunft des Lernens müssen alle an einem Strang ziehen – von der Politik, den Unternehmen, den Ministerien bis zu den Schulleitungen und Lehrkräften selbst. Im Kompendium kommen deshalb auch Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, Politik und Lehrerverbände zu Wort. Letztere fordern mehr Freiräume in der Fort- und Weiterbildung. Dadurch können einerseits Defizite – zum Beispiel in der Digitalität – ausgeglichen werden. Andererseits soll dies Neugierde wecken, Neues auszuprobieren.
Ein wichtiger Schritt ist auch, Anreize zu schaffen, um Innovationen zu fördern, Fördermittelgeber zu finden und die Chancen des DigitalPakt Schule zu nutzen. Denn Schule als System kann sich nur dann weiterentwickeln, wenn alle Chancen genutzt werden. Die Digitalisierung bietet eine solche Chance – in den einzelnen Schulen, auf Landesebene, auf internationaler Ebene.
Internationale Beispiele und Vorbilder
Dabei können wir auch von den Erfahrungen anderer europäischer Länder wie Finnland, Österreich oder auch Polen lernen. Bei unserem östlichen Nachbarland wird Künstliche Intelligenz (KI) in Schulen unterrichtet und gefördert. So wurden im Jahr 2020 – finanziert durch das polnische Wirtschaftsministerium – rund 400 KI-Labore an polnischen Schulen eingerichtet. Und eine neue Initiative zielt darauf ab, weitere 4.000 Lehrkräfte fit in KI zu machen.
Das Ziel des Netzwerks Digitale Bildung ist klar: Kinder und Jugendliche sollen für die Zukunft und die digitalisierte Arbeits- und Lebenswelt gewappnet sein. Dafür müssen alle Beteiligten – von den Schulträgern und Kommunen, Schulleitungen und Lehrkräften bis zu den Eltern und Schülerinnen und Schülern selbst – Schule und Bildung neu denken. Um dies zu erreichen, müssen wir jetzt die Grundlagen dafür schaffen. Denn was wir heute im Schulsystem verändern, wird sich erst in fünf bis zehn Jahren auswirken.
Über das Netzwerk Digitale Bildung
Das Netzwerk Digitale Bildung wird von verschiedenen Partnern aus der Wirtschaft getragen. Neben einer finanziellen Unterstützung bringen sie sich mit ihrer fachlichen Expertise im Bereich Digitale Bildung ein. Das Netzwerk Digitale Bildung bietet konkrete Impulse und Handlungsempfehlungen für einen Unterricht mit digitalen. Die Informationsangebote richten sich an Lehrkräfte, Schulleitungen, Entscheidungsträger aus Politik, Städten, Kommunen und Gemeinden sowie eine an der Gestaltung von Bildung interessierte Öffentlichkeit.
Weitere Informationen
Quelle: Pressemitteilung Netzwerk Digitale Bildung