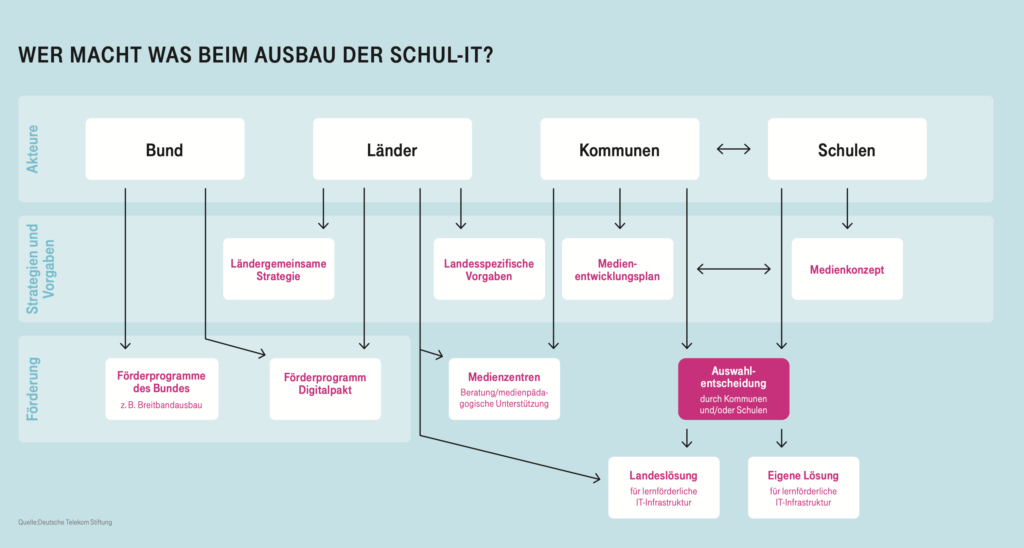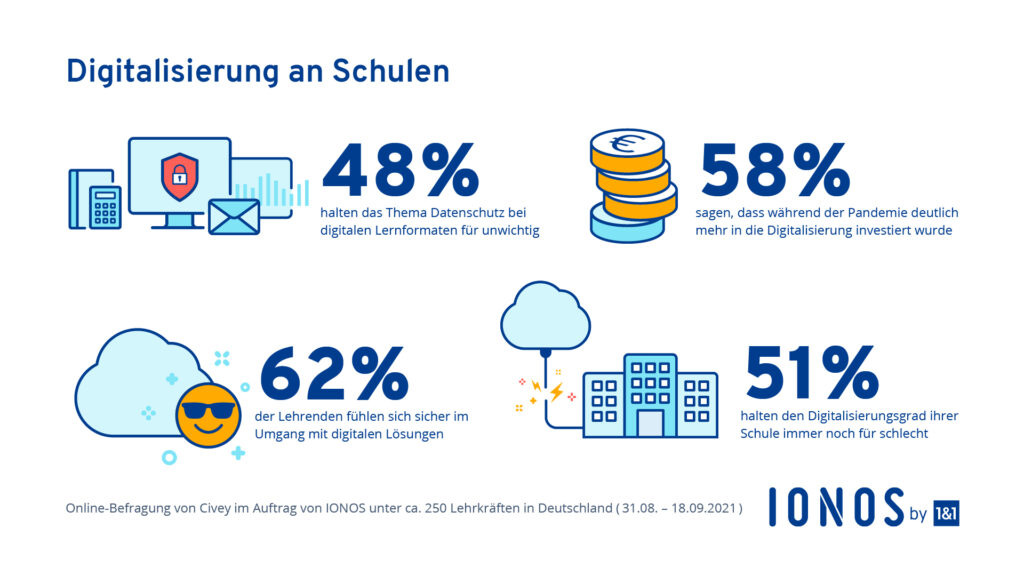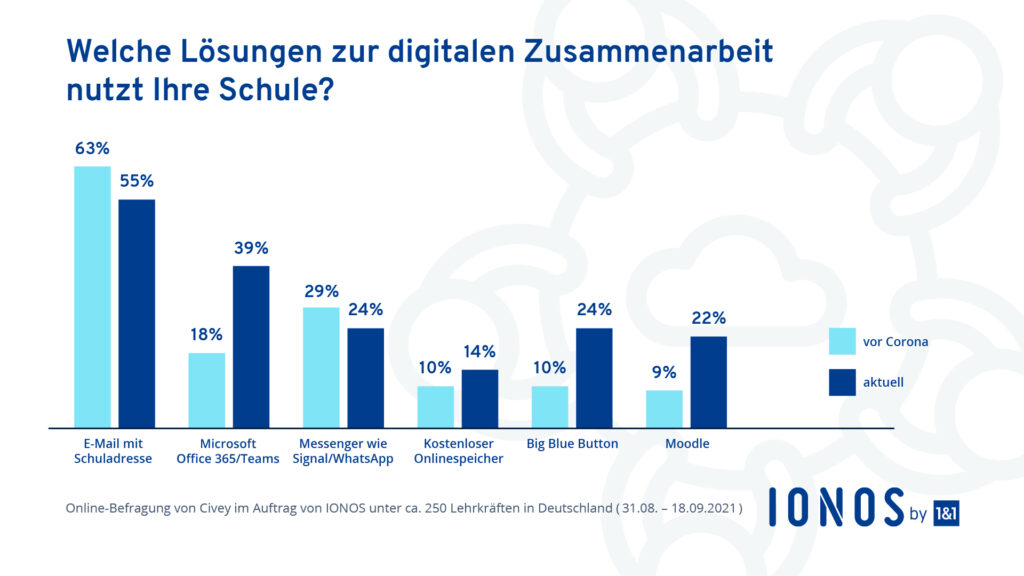Bildungsgewerkschaft zur Studie „Digitalisierung im Schulsystem 2021“
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnt eine Strategie- und Qualitätsoffensive für Medienkompetenz an den Schulen an. „Nach dem Digitalisierungsschub durch die Coronakrise brauchen die Schulen dringend mehr zeitliche und personelle Ressourcen, um gute Rahmenkonzepte für eine digitale Lehr- und Lernstrategie zu entwickeln und diese auch umzusetzen“, sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied Schule, mit Blick auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie „Digitalisierung im Schulsystem 2021“. Sonst drohe die Weiterentwicklung der Medienkompetenz der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler „im Technikstress unterzugehen“.
Offensive für mehr Medienkompetenz nötig
„Wir dürfen die Digitalisierung an der Schule nicht auf Ausstattungsfragen reduzieren. Drei Balken im W-LAN-Symbol bedeuten nicht automatisch gute Bildung“, betonte Ralf Becker, GEW-Vorstandsmitglied Berufliche Bildung und Weiterbildung. Er machte deutlich, dass digitale Ausstattung und Infrastruktur wichtig seien, weil sie die Grundlage bilden, damit alle Schulen digitale Tools und Technik gleichberechtigt nutzen können. „Digitalisierung an Schulen ist aber eben auch eine Qualitäts- und Zeitfrage. Der pädagogisch-sinnvolle Einsatz digitaler Technik und Formate im Unterricht erfordert Zeit sowie Ressourcen für Fort- und Weiterbildung ebenso wie für die Anpassung analoger an digitale Formate, wenn dies möglich ist. Lehrkräfte dürfen nicht mit zusätzlichen IT-Aufgaben belastet werden, sondern sollen sich in ihrer Arbeitszeit auf den Lehrberuf konzentrieren können“, sagte Becker. Die Digitalpaktmittel für IT-Administratorinnen und -Administratoren müssten endlich an den Schulen ankommen.
Digitale Kluft zwischen den Schulen
„Die Untersuchung zeigt die große digitale Kluft zwischen den Schulen in Deutschland“, unterstrichen Studienleiter Frank Mußmann und Co-Autor Thomas Hardwig, Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften der Universität Göttingen. „Die Unterschiede zwischen digitalen Vorreiter- und Nachzügler-Schulen beim Lehren und Lernen mit digitalen Medien und Tools sowie der digitalen Infrastruktur sind gewaltig. Diese Spaltung ist besorgniserregend, denn die empirischen Ergebnisse der Studie machen deutlich: Medienkompetenzen entwickeln sich bei Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern dann besonders gut, wenn es praxistaugliche Medien und Techniken gibt und diese in eine entwickelte digitale Schulstrategie eingebettet sind.“
Zusätzliche Kapazitäten schaffen
Diese Strategie erfordere zeitliche Kapazitäten und personelle Ressourcen der Schulen, sagte Mußmann. Genau hier gebe es jedoch ein Problem: „Die Lehrkräfte arbeiten am Limit. Ihre Belastung war auch während der Ad-hoc Digitalisierung in der Pandemie sehr hoch und hat die ohnehin angespannte Arbeitssituation an Schulen sowie die Entgrenzungserfahrungen der Lehrkräfte noch einmal verschärft“, hob der Studienleiter hervor. „Ausgelöst durch Coronakrise und Digitalisierungsschub ist die wöchentliche Arbeitszeit der Lehrkräfte um rund 30 bis 60 Minuten gestiegen. Dabei überschritt die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Lehrkräfte schon vor der Pandemie die Normarbeitszeit deutlich. Von einem Viertel sehr stark belasteter Lehrkräfte wird sogar die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden in der Woche überschritten. Das ist eine sehr hohe Arbeitsbelastung und gefährdet die Gesundheit.“
Mehr institutionelle Unterstützung
Lehrkräfte und Schulen hätten während der Coronakrise vielfach in Eigeninitiative pragmatische Lösungen gefunden, um digitale Medien und Techniken einzusetzen sowie digitale Lehr- und Lernkonzepte zu entwickeln und mit diesen zu arbeiten, hob Mußmann hervor. Seit der Pandemie würden digitale Medien häufiger genutzt als in der Vor-Corona-Zeit, Lehrkräfte hätten ihre digitalen Kompetenzen an gestiegene Anforderungen angepasst. Der Studienleiter bemängelte aber die meist unzureichende institutionelle Unterstützung. „Eine fehlende systematische Schulentwicklung gefährdet die Zukunft der Digitalisierung“, sagte er.
Nachzügler Schulen im „Technikstress“
An den so genannten digitalen Nachzügler-Schulen sei der „Technikstress“ besonders hoch. An den gut ausgestatteten digitalen Vorreiter-Schulen, an denen die Rahmenkonzepte weit entwickelt sind, litten die Lehrkräfte weniger unter diesem Stress, seien zufriedener mit ihrer Arbeit und hätten insgesamt bessere berufliche Chancen. „Die digitale Spaltung zwischen Vorreiter- und Nachzügler Schulen muss überwunden werden. Die Möglichkeiten der Lehrkräfte, einen zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Medien und Techniken umzusetzen, sind extrem ungleich verteilt. Das wirkt sich auch negativ auf die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler aus. Die Folge: Die soziale Spaltung in der Gesellschaft vertieft sich“, sagte Bensinger-Stolze. „Das akzeptieren wir nicht.“
Partizipation und Medienmündigkeit im Zentrum
Becker forderte ein Umdenken in der Digitalisierungsstrategie: „Wir brauchen eine Strategieoffensive, die die Kompetenzentwicklung im Sinne von Partizipation und Medienmündigkeit ins Zentrum stellt – und Digitalisierung nicht als Selbstzweck sieht. Medienkompetenz ist ein wesentlicher Schlüssel zu politischer, kultureller und gleichberechtigter Teilhabe der Menschen an der Gesellschaft im digitalen Zeitalter.“
Lehrkräfte in allen Bundesländnern befragt
Info: In der Studie „Digitalisierung im Schulsystem 2021. Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen und Perspektiven von Lehrkräften in Deutschland“ wurden im Januar und Februar 2021 Lehrkräfte der Sekundarstufen I und II aus allen Bundesländern befragt. Die Studie erlaubt bundesweit repräsentative Befunde. Sie wurde an der Georg-August-Universität in Göttingen unter der Leitung von Dr. Frank Mußmann, Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften, in Zusammenarbeit mit dem Umfragezentrum Bonn durchgeführt. Das Konsortium hat untersucht, wie Schulen und Lehrkräfte auf die Herausforderungen der Digitalisierung in Pandemie-Zeiten reagieren, wie sich ihre Arbeit, ihre Arbeitszeit und ihre Belastungen verändert haben und welche Chancen und Risiken digitale Arbeitsformen für die Lehrkräfte bergen. Die Studie zeigt zudem zentrale Entwicklungs- und Gestaltungsbedarfe auf und gibt Empfehlungen für die Zukunft.