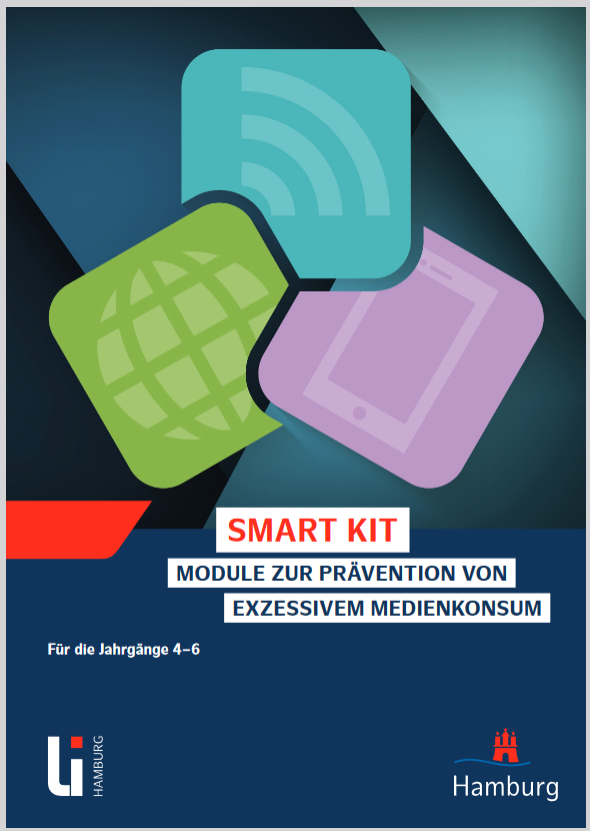Der Ursprung sozialen Lernens beim Menschen liegt in der Interaktion von Säugling und seinen Bezugspersonen
Ohne darüber nachzudenken, lernt der Mensch laufend von anderen. Soziales Lernen vermeidet mühsames Ausprobieren, das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Doch woher kommt diese Fähigkeit, die Grundlage für kulturelles Lernen und damit den evolutionären Erfolg der menschlichen Spezies ist? Eine Studie unter der Leitung von Professor Markus Paulus, Inhaber des Lehrstuhls für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), belegt, dass sie in der frühesten Kindheit wurzelt. „Kinder erwerben die Fähigkeit zur Imitation, weil sie selbst von ihren Bezugspersonen imitiert werden“, sagt Markus Paulus.
Kinder sind Imitationswunder – ihre Eltern sorgen dafür, dass sie es werden
Für die Studie wurde die Interaktion zwischen Mutter und Kind über mehrere Monate untersucht. Zum ersten Mal kamen die Babys im Alter von sechs Monaten ins Labor, die letzte Untersuchung fand im Alter von 18 Monaten statt. Im Rahmen spielerischer Situationen wurden Interaktionen und Imitationen von Mutter und Kind analysiert.
Die Längsschnittstudie zeigt: Je feinfühliger die Mutter mit ihrem sechs Monate alten Kind umging und je öfter sie es nachahmte, desto stärker war bei diesem im Alter von 18 Monaten die eigene Fähigkeit ausgeprägt, andere zu imitieren.
In der Interaktion von Eltern und Kind ist das gegenseitige Nachahmen ein Zeichen von Kommunikation. Eltern gehen auf die Signale des Kindes ein, spiegeln und verstärken sie. Es kommt zu einer gegenseitigen Imitation von Handlungen und Gesten. „Über diese Erfahrungen verbindet sich das, was das Kind fühlt und tut, mit dem, was es sieht. Es bilden sich Assoziationen heraus. Das visuelle Erleben wird mit der eigenen motorischen Handlung verknüpft“, erläutert Markus Paulus den neurokognitiven Prozess.
Durch Nachahmung lernen Kinder zum Beispiel, Objekte zu nutzen, kulturtypische Gesten wie zum Beispiel das Winken ebenso wie den Erwerb von Sprache. „Kinder sind Imitationswunder. Das Nachahmen ebnet ihnen den Weg zu ihrer weiteren Entwicklung. Mit Imitation beginnt der kulturelle Prozess der Menschwerdung“, so Markus Paulus. Lange galt in der Psychologie die Theorie, dass die Fähigkeit zur Nachahmung angeboren sei. Die LMU-Studie ist nun ein weiterer Beleg dafür, dass sie erst erworben werden muss.
Auf der Nachahmung basiert die kulturelle Weitergabe von Wissen
Entscheidend dafür, wie gut Kinder lernen, andere zu imitieren, ist, dass Eltern feinfühlig auf ihr Kind reagieren. Als Feinfühligkeit wird die Fähigkeit einer Bezugsperson bezeichnet, Signale des Kindes wahrzunehmen und rasch und adäquat darauf zu reagieren. „Die Feinfühligkeit der Mutter ist ein Prädiktor dafür, wie stark sie ihr Kind nachahmt“, sagt Dr. Samuel Essler, Erstautor der Studie.
Die Studie zeigt zudem, was den Menschen als soziales Wesen ausmacht: Seine individuellen Fähigkeiten entwickeln sich erst durch die Interaktion mit anderen. Sie sind der besonderen Art zu verdanken, wie der Mensch seinen Nachwuchs aufzieht.
„Indem Kinder Teil einer sozialen Interaktionskultur sind, in der sie imitiert werden, lernen sie von anderen zu lernen. Dieses Wechselspiel hat über Generationen und Jahrtausende zur kulturellen Evolution des Menschen geführt“, sagt Markus Paulus. „Durch soziales Lernen müssen Handlungen oder bestimmte Techniken nicht immer wieder neu erfunden werden, sondern es gibt eine kulturelle Weitergabe von Wissen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Fähigkeit zur Imitation und damit zum kulturellen Lernen selbst ein Produkt kulturellen Lernens ist, insbesondere der Eltern-Kind-Interaktion”, sagt Markus Paulus.
Originalpublikation: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982223011648?dgcid=coauthor
Quelle: LMU Stabsstelle Kommunikation und Presse/Ludwig-Maximilians-Universität München