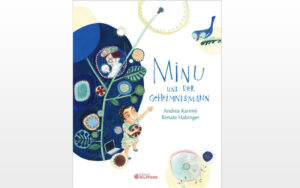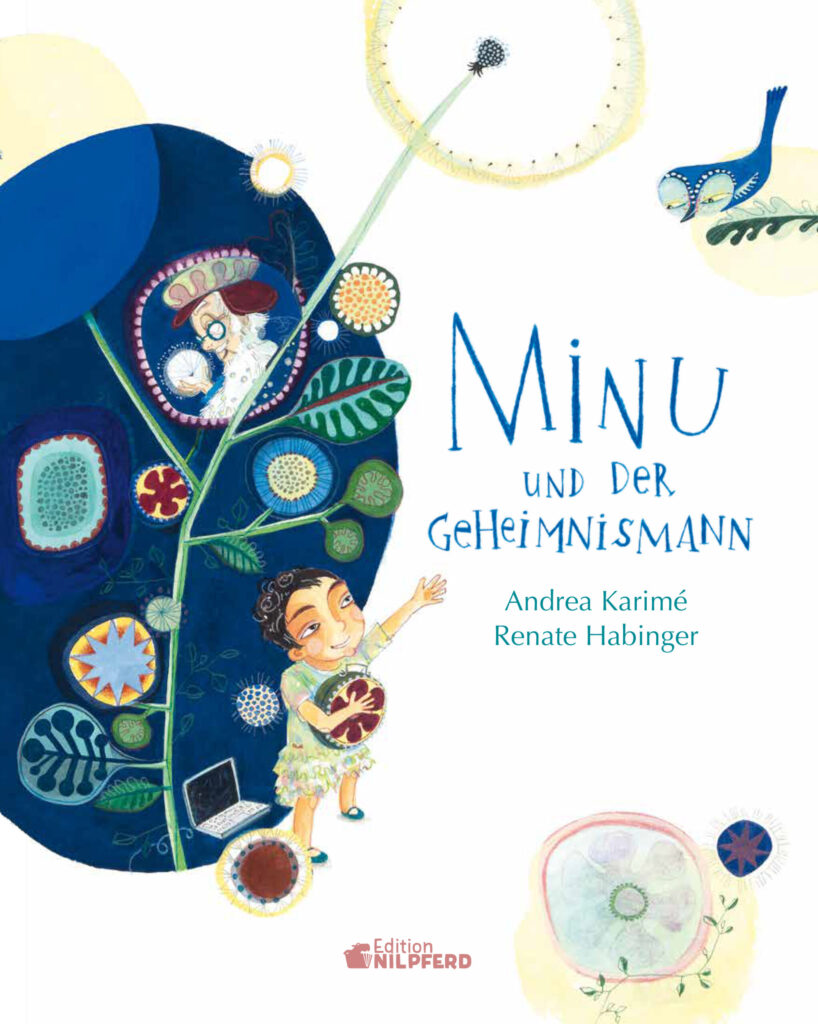Väter wollen Kinder empathisch und verständnisvoll erziehen

Studie zum Selbstbild und Selbstverständnis von Vätern der TU Braunschweig und der FH Kiel
Die Rolle von Vätern ist in den vergangenen Jahren immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus gerückt. Debatten wie #dazuhatpapanichtszusagen, Diskussionen um einen 14-tägigen Vaterschutz und nicht zuletzt die Erweiterung der Elternzeit um zwei Vätermonate spiegeln diese Entwicklung wider. „Trotz der vermehrten Diskussion um die Rolle von Vätern ist diese seit einigen Jahren nicht mehr umfassend wissenschaftlich untersucht worden. Diese Lücke wollten wir mit unserer Studie schließen“, erklärt Projektleiterin Dr. Kim Bräuer von der TU Braunschweig. Im Rahmen der VAPRO-Studie befragte das Team um Bräuer und Prof. Dr. Kai Marquardsen von der Fachhochschule Kiel 2.200 Väter online und führten 55 qualitative Interviews. Dabei berücksichtigten sie neben rechtlichen und biologischen Vätern auch Pflegeväter, Väter in Co-Parenting-Konstellationen und homosexuelle Väterpaare. Außerdem wurden nicht nur die Männer selbst befragt, sondern auch die (Eigen-)Darstellung von Vaterschaft in sozialen Medien analysiert.
Das Bild vom Vater, der mit seinem Einkommen die Familie ernährt und mit den Kindern höchstens am Wochenende spielt, ist passé. Tatsächlich ist es Vätern heute vor allem wichtig, ihre Kinder „empathisch und verständnisvoll“ zu erziehen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der VAPRO-Studie. Das Ideal des emotionalen Vaters ist weit verbreitet. So ist es fast 60 Prozent der Väter am wichtigsten, dass sie ihrem Kind bzw. ihren Kindern Zuneigung zeigen. Der Trend zu vermehrter aktiver Vaterschaft sei klar erkennbar, so die Wissenschaftler*innen. Dabei engagieren sich die Väter am häufigsten in der Kinderbetreuung, indem sie zum Beispiel mit den Kindern spielen. Deutlich seltener übernehmen die Väter aktive Erziehungsmaßnahmen.
Das Bild vom Vater als Ernährer dominiert nicht mehr
Ein Großteil der befragten Väter hat sich von dem Bild des Vaters als Ernährer gelöst. Nur rund 12 Prozent von ihnen halten es für ihre wichtigste Aufgabe, der Familie finanzielle Sicherheit zu bieten. „Die von uns befragten Väter haben angegeben, dass ihnen monetäre Werte nicht so wichtig seien, wie soziale oder emotionale Werte“, erklärt Prof. Dr. Kai Marquardsen. In diesem Zusammenhang kritisierten viele der Interviewten ihre eigenen Väter unter anderem als „zu bestimmend“, als „abwesend“ und „mit der Arbeit zu beschäftigt“. Sie nutzen ihre Väter als „negatives Vorbild“ und betonen, dass sie selbst als Vater bewusst anders handeln würden.
Dennoch sind fast 85 Prozent der Väter wöchentlich 40 Stunden oder mehr erwerbstätig, während fast drei Viertel der anderen Elternteile nicht oder maximal 30 Stunden in der Woche arbeiten. Trotzdem nimmt fast jeder zweite Vater an, dass er sich genauso viel um familiäre Angelegenheiten der Kinderbetreuung kümmert, wie der andere Elternteil. Lediglich jeder zehnte Vater übernimmt die meisten Aufgaben der Familienarbeit. Dies sind vor allem Väter, die ihre Erwerbstätigkeit beendet oder deren Umfang reduziert haben, um mehr Zeit für ihre Familie und die Versorgung der Kinder zu haben.
Viele Väter, auch das ist eine Erkenntnis der Studie, geben an, ihren eigenen Vorstellungen guter Vaterschaft nicht gerecht zu werden. „Hier zeigen sich Parallelen zur Mutter als Allrounderin, die im Job erfolgreich sein muss und gleichzeitig liebevoll die Kinder und ihre Verwandten umsorgt“, erklärt Kim Bräuer. „Der Trend geht also weg von der ‚klassischen‘ Rollentrennung hin zu einem ‚Alle-erfüllen-alle-Rollen‘ und dieses möglichst perfekt. Dabei erleben die Väter nicht nur einen Work-Family-Konflikt. Es scheint auch darum zu gehen, sich in ihrem Freundeskreis, in Vereinen oder bei der Versorgung der Eltern einzubringen und ihren Kindern auf diese Weise soziale Werte vorzuleben,“ so Bräuer.
Väter bloggen nicht über Armut
Im Rahmen ihrer Studie haben die Sozialwissenschaftler*innen die Instagram-Accounts von sieben sehr populären Väterbloggern und deren Bild von Vaterschaft analysiert. Hier herrscht das Ideal des zumeist weißen, aktiven Vaters. Vaterschaft in Armut oder Vatersein mit Migrationserfahrung würden hingegen kaum thematisiert, erklärt Prof. Marquardsen. „Das lässt sich damit erklären, dass Armut mit Scham behaftet ist und Väter in Armutslagen sich – auch virtuell – nicht offenbaren wollen. Väter, deren Leben von einem geringen Einkommen geprägt ist oder die auf Leistungen vom Staat angewiesen sind, finden unter Väterbloggern also niemanden in ähnlicher Lebenslage.“ Auch unter #ichbinarmutsbetroffen fanden die Wissenschaftler*innen nur wenige Berichte von Vätern in Armutslagen.
Es sei schwierig gewesen, für Interviews Kontakt zu Betroffenen herzustellen, da diese in besonderer Weise unter dem Druck gesellschaftlicher Normalitätsvorstellungen stünden, erklärt der Kieler Sozialwissenschaftler: „Selbstverständlich finden wir auch unter Vätern in Armutslagen eine Vielfalt im Erleben von Vaterschaft. Aber im Unterschied zu anderen Vätern ist für sie vor allem die materielle Versorgung der Familie wichtigeres Thema. In unseren Interviews wurde deutlich, dass für sie insbesondere Herausforderungen auf materieller Ebene eine Rolle spielen, die bei Vätern in gesicherten Verhältnissen kein Thema waren “, so Marquardsen. „Insgesamt besteht bezüglich des Erlebens von Vaterschaft von Vätern in Armut aber weiter dringender Forschungsbedarf. Nicht zuletzt wissen wir noch zu wenig darüber, welche kurz- und längerfristigen Einflüsse gesellschaftliche Krisenereignisse wie Corona oder eine steigende Inflation auf die Praxis gelebter Vaterschaft in verschiedenen Milieus haben.“
Handlungsempfehlungen für die Praxis
Ziel des Projekts war es auch, Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber*innen, Koordinator*innen von Väternetzwerken und politische Akteur*innen zu entwickeln, um die Lebenslagen von Vätern sichtbarer zu machen und ihre Situation und die ihrer Familien nachhaltig zu verbessern. Väterarbeit, so die Empfehlung der Forschenden, solle sich verstärkt auf deren alltägliches Handeln beziehen. Es gehe weniger darum, ein neues Bild von Vaterschaft zu vermitteln, als die Väter stärker in alltägliche Aufgaben einzubinden, erklärt Bräuer: „Es wäre denkbar, Väter aktiv als Elternsprecher anzufragen, Väterschwimmkurse anzubieten oder sie aktiv zum Beispiel in Elternchats anzusprechen.“ Unterstützung wünschen sich die Wissenschaftler*innen außerdem durch entsprechende familienpolitische Reformen. „Das würde es vielen Vätern leichter machen, spezielle Angebote der Arbeitgeber*innen auch tatsächlich anzunehmen.“
Zur Studie
Die VAPRO Studie hatte eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren und wurde von der Stabstelle für Chancengleichheit der TU Braunschweig und dem Braunschweiger Zentrum für Gender Studies finanziert. Die Forscher*innen wählten einen Methoden-Mix und werteten 55 qualitative Interviews, eine Online-Umfrage mit bundesweit 2.200 Teilnehmern und sieben Instagram-Accounts von Väterbloggern aus.
Weitere Informationen
Abschlussbericht: https://leopard.tu-braunschweig.de/content/index.xml
Projekthomepage: https://www.tu-braunschweig.de/chancengleichheit/familienbuero/vaeter
VAPRO-Instagram-Account: https://www.instagram.com/dadsaredads/
Bianca Loschinsky, Technische Universität Braunschweig