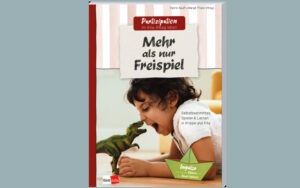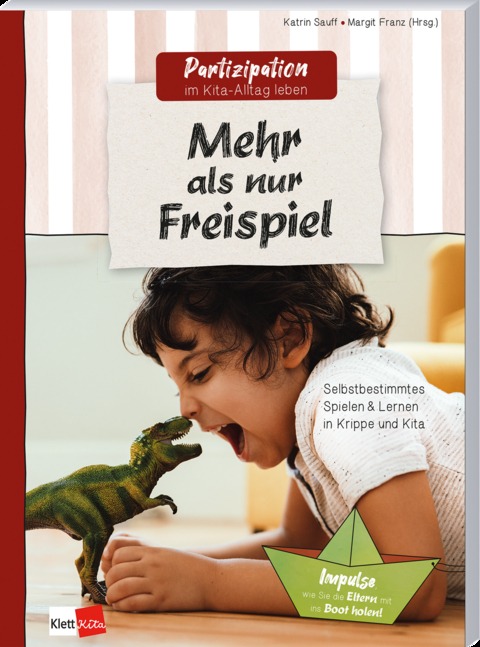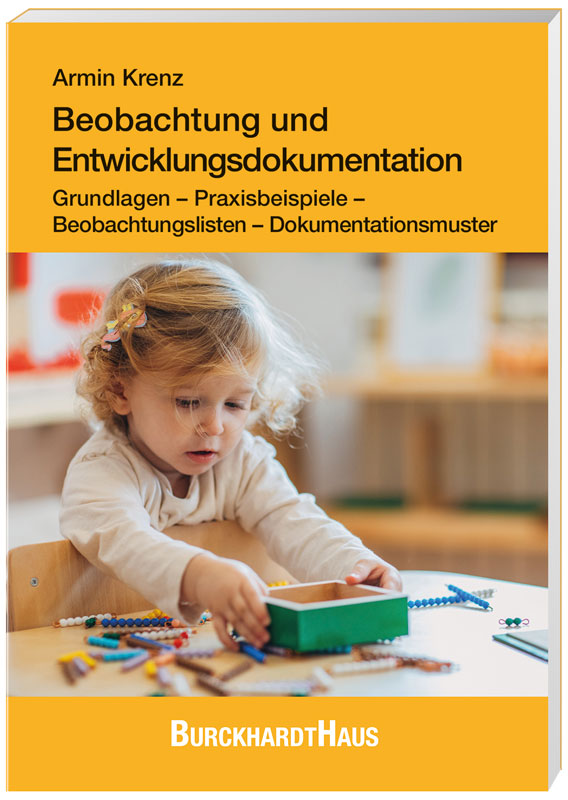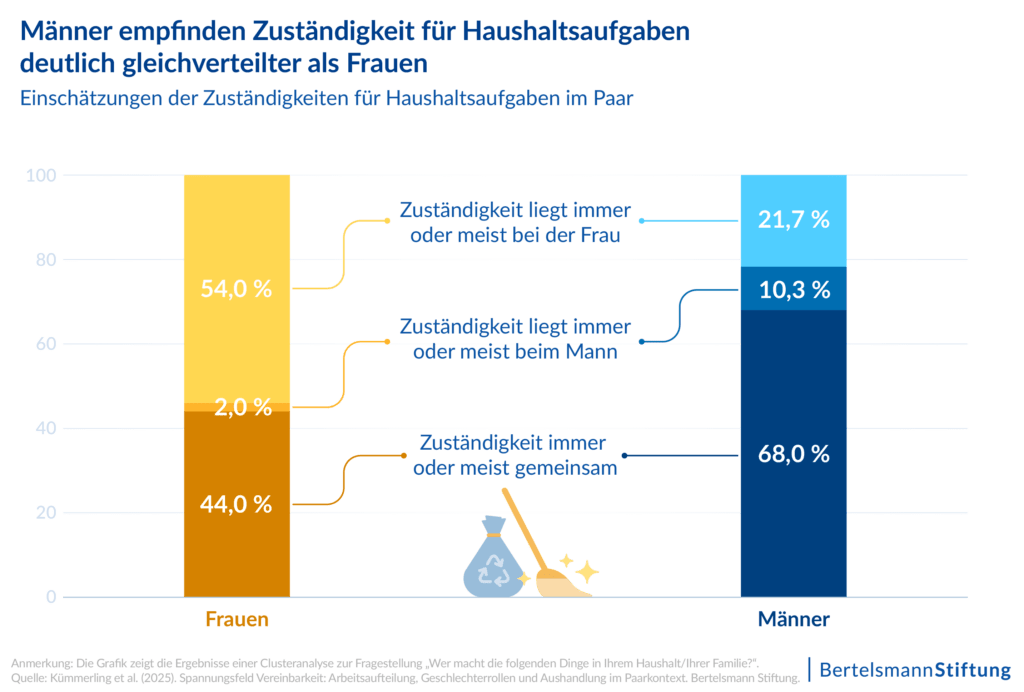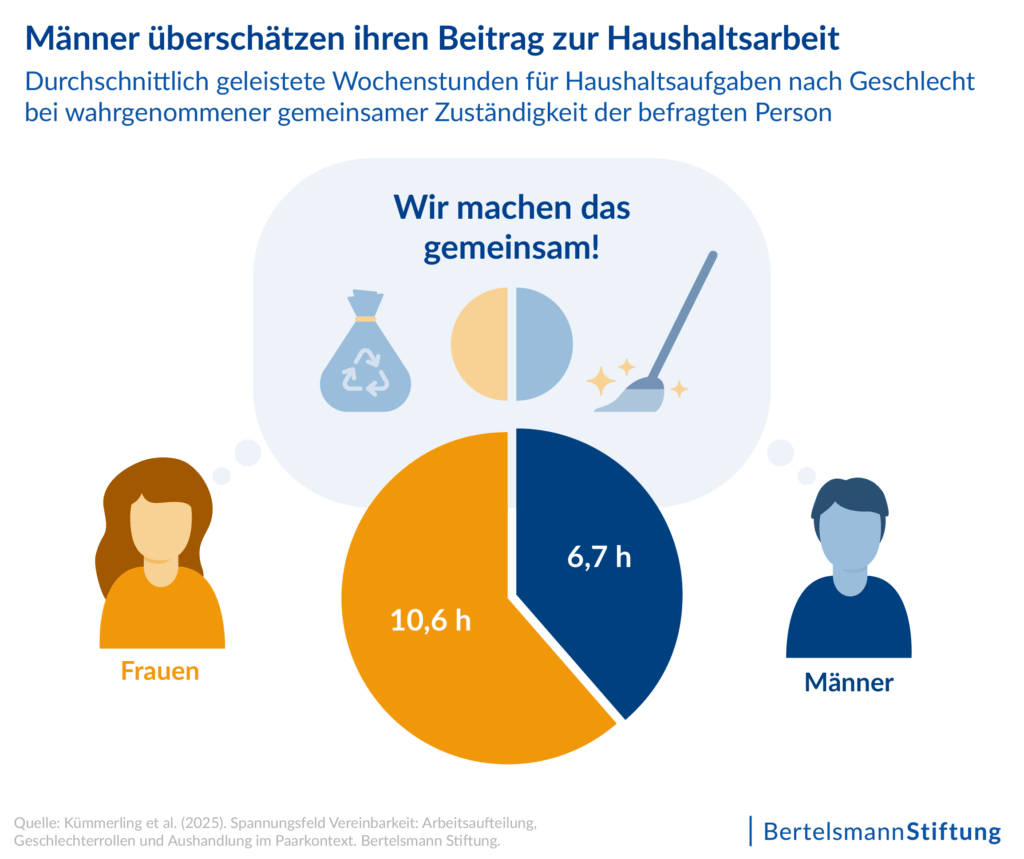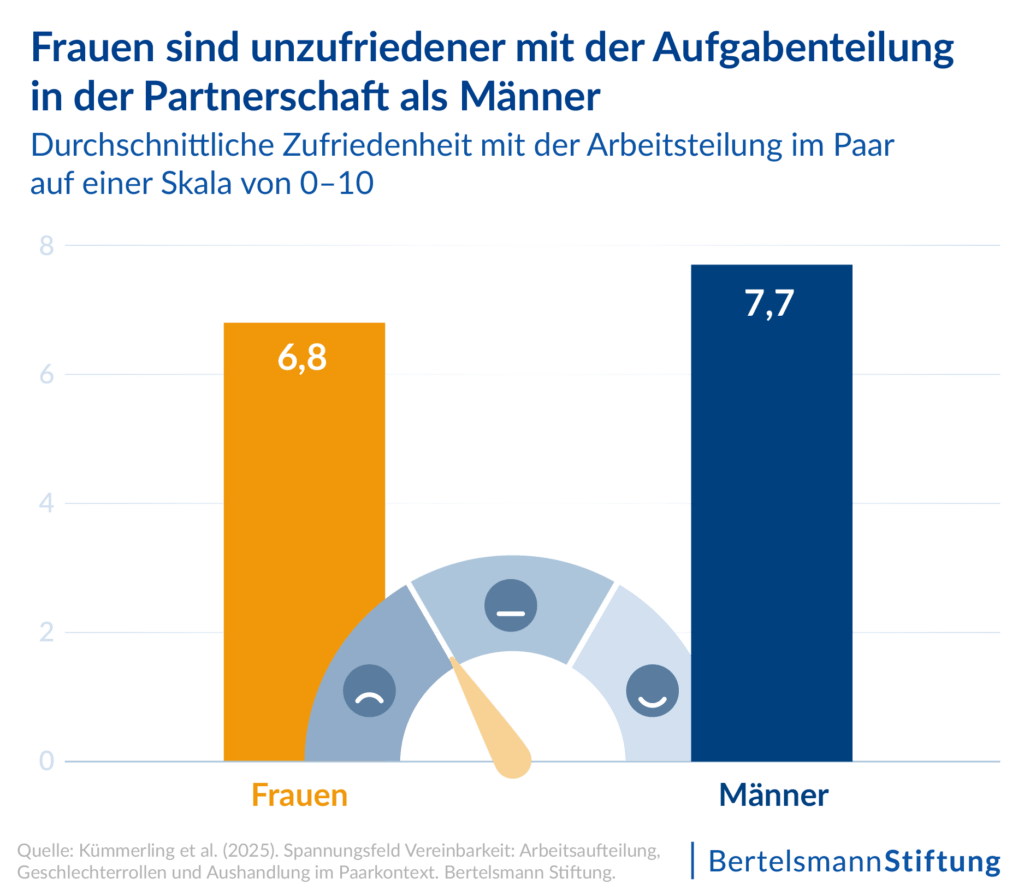Masernschutz in Deutschland noch immer unzureichend

Laut dem aktuellen Arzneimittelreport der Barmer haben nur 87 Prozent der Zweijährigen den vollständigen Masernimpfschutz erhalten
Der Masernschutz bei Kindern bleibt in Deutschland trotz Einführung der Impfpflicht im Jahr 2020 hinter den angestrebten Zielen zurück. Dies geht aus dem aktuellen Arzneimittelreport der Barmer hervor, bei dem Impfquoten von Kindern bis zum sechsten Lebensjahr untersucht werden. So hatten im Jahr 2022 bundesweit 87 Prozent der Zweijährigen den vollständigen Masernimpfschutz erhalten. Das entspricht einer Steigerung um rund acht Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2019. Um eine Herdenimmunität zu erreichen, ist jedoch eine Immunisierungsrate von mindestens 95 Prozent notwendig.
„Die Masernimpfpflicht hat zwar die Impfquote gesteigert, aber das angestrebte 95 Prozent-Ziel nach wie vor in allen Bundesländern verfehlt. Um dies zu erreichen, sind weitere Schritte erforderlich wie etwa zielgerichtete Impfkampagnen und eine intensivere Aufklärung, um Vorbehalte gegen Impfungen auszuräumen“, sagt Prof. Dr. med. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer.
Bislang sei es nicht gelungen, eine flächendeckende Herdenimmunität zu gewährleisten. Dies erschwere die Bekämpfung der hochinfektiösen Krankheit erheblich. Eine Herdenimmunität sei entscheidend, um nicht nur geimpfte Menschen, sondern auch jene zu schützen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten.
Erhebliche regionale Unterschiede
Wie aus dem Report weiter hervorgeht, ist der Masernschutz in Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern besonders lückenhaft. Hier wurden lediglich etwa 77 beziehungsweise etwa 84 und etwa 85 Prozent der Zweijährigen vollständig gegen Masern geimpft. Damit liegen die Werte um bis zu zehn Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt.
Insgesamt waren im Jahr 2022 annähernd fünf Prozent der im Jahr 2020 geborenen Kinder in Deutschland ohne jegliche Masernimpfung. „Impflücken gefährden die Gesundheit der Kinder und schwächen die Schutzwirkung für alle. Je größer diese in einzelnen Regionen ausfallen, desto mehr steigt dort das Risiko für regionale Masernausbrüche. Weltweit ist die Zahl der Todesfälle durch Masern im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent gestiegen“, sagt Prof. Dr. med. Daniel Grandt, Studienautor des Barmer-Arzneimittelreports und Chefarzt am Klinikum Saarbrücken.
Zunehmende Impfraten, aber Lücken bleiben bestehen
Laut Arzneimittelreport haben sich die Impfraten für Masern, Mumps und Röteln, die üblicherweise als Kombinationsimpfung verabreicht werden, seit Einführung der Masernimpfpflicht zwar merklich verbessert. Im Vergleich zu den Geburtskohorten der Jahre 2016 und 2017 stieg der Anteil der vollständig geimpften Kinder um fast zehn Prozentpunkte. Dennoch sind nach wie vor viele Kinder nicht ausreichend geschützt. Rund acht Prozent erhalten in den ersten beiden Lebensjahren nur eine statt der empfohlenen zwei Impfdosen, was den individuellen Schutz beeinträchtigen kann.
Zahlreiche ungeimpfte Kleinkinder
Nach den Ergebnissen des Arzneimittelreports gibt es immer noch Kinder, die in den ersten beiden Lebensjahren komplett ungeimpft sind. Bundesweit betrifft dies fast drei Prozent der im Jahr 2020 geborenen Kinder, hochgerechnet etwa 20.800. „Es ist alarmierend, dass immer noch so viele Kinder keinerlei Impfschutz haben. Diese Impflücke gefährdet nicht nur die betroffenen Kinder, sondern alle, die sich nicht selbst durch Impfung schützen können“, sagt BARMER-Chef Straub.
Bayern und Baden-Württemberg hätten mit rund vier Prozent den höchsten Anteil ungeimpfter Kinder, während Brandenburg mit 1,5 Prozent die geringste Quote ungeimpfter Kinder bis zwei Jahre aufweise. Letztmalig wurden diese Zahlen für den Report des Jahres 2019 für die im Jahr 2016 geborenen Kinder erhoben. Damals lag die Quote der komplett ungeimpften Kinder bundesweit bei etwas mehr als vier Prozent, was einer Verbesserung um 1,6 Prozentpunkte entsprach.
Impfquoten bei weiteren Infektionskrankheiten
Neben dem Masernschutz liefert der Arzneimittelreport auch Daten zu den Impfquoten bei anderen von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Schutzimpfungen. So zeigen die Daten etwa, dass bis zum Ende des zweiten Lebensjahres bei den Impfungen ohne Impfpflicht, wie Diphtherie, Keuchhusten, Polio, Hepatitis B, Impfquoten zwischen 81 und rund 84 Prozent erreicht werden.
Die Impfung gegen Rotaviren bildet mit 72,4 Prozent das Schlusslicht. „Zentrales Ergebnis der Analysen ist, dass die angestrebten Impfquoten für die 13 empfohlenen Impfungen zur Grundimmunisierung bei keiner Impfung erreicht werden, auch nicht für Masern nach Einführung der Impfpflicht. 521 Masernfälle und ein Todesfall in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 in England zeigen noch einmal, dass ohne Erreichen der Herdenimmunität massive Ausbrüche von Masernerkrankungen jederzeit möglich sind“, sagt Grandt.
Service
Das ePaper zur Studie finden Sie hier: bifg – BARMER Institut für Gesundheitssystemforschung
Quelle: Pressemitteilung Barmer