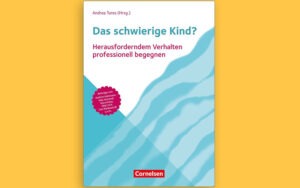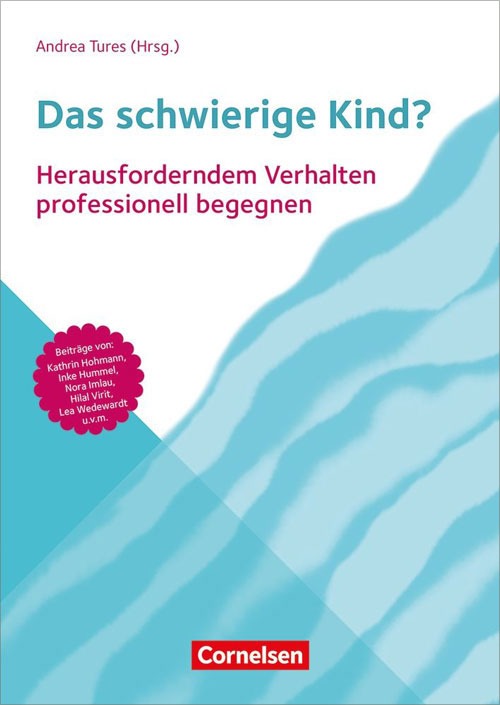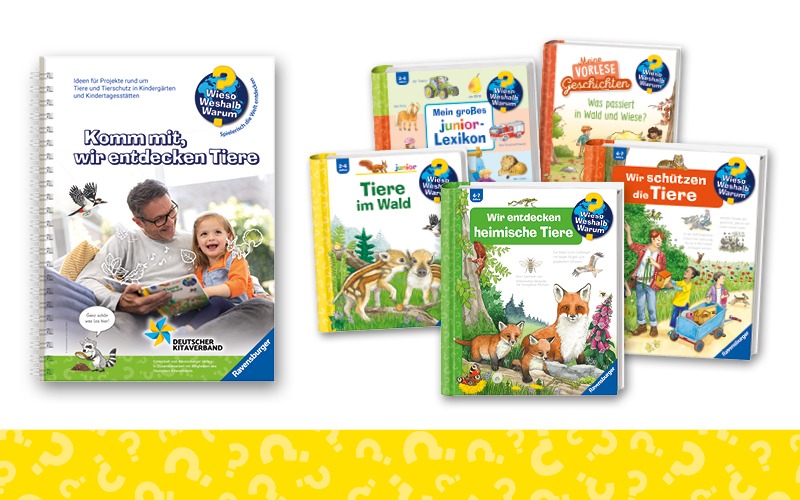Soziale Teilhabe: Was Kinder und Jugendliche wirklich brauchen

Laut der neuen Bertelsmann-Studie sind für Kinder und Jugendliche vor allem ihre Freund*innen und die digitale Teilhabe wichtig
Kinder und Jugendliche wünschen sich vor allem eines: soziale Teilhabe. Das zeigt die aktuelle Studie „Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für ein gelingendes Aufwachsen“ der Bertelsmann Stiftung. Demnach sind Freundschaften und zwischenmenschliche Beziehungen für junge Menschen zwischen zehn und 15 Jahren zentral für ein gutes Leben. Rund ein Drittel der Befragten nennt soziale Kontakte zu Freund*innen und Gleichaltrigen als wichtigste Lebensgrundlage – noch vor der eigenen Familie, die von etwa 20 Prozent an zweiter Stelle genannt wird.
Dabei zeigt sich: Soziale Beziehungen sind auch im digitalen Raum von großer Bedeutung. Mehr als die Hälfte der befragten Kinder und Jugendlichen (54 Prozent) gibt an, auf Handy und mobiles Internet am wenigsten verzichten zu können. Digitale Teilhabe ist somit eng mit sozialer Teilhabe verknüpft.
Finanzielle Mittel als Schlüssel zur Teilhabe
Die finanziellen Prioritäten der jungen Generation spiegeln diese Bedürfnisse deutlich wider. Für neun von zehn Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, Geld für gemeinsame Aktivitäten mit Freund*innen zur Verfügung zu haben. Auch Konsumgüter wie Kleidung, Technik oder Kosmetik (67 Prozent), Hobbys (61 Prozent) sowie Internet und Telefon (55 Prozent) stehen weit oben auf der Liste. Bemerkenswert: Rund die Hälfte der Befragten möchte zudem Geld sparen – ein Hinweis auf ein ausgeprägtes Bewusstsein für die eigene finanzielle Situation.
Erfreulich ist, dass sich das Taschengeld kaum nach dem Einkommen der Eltern richtet. Auch Haushalte mit geringerem Einkommen bemühen sich, ihren Kindern eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen.
Geldmangel schränkt soziale Teilhabe ein
Trotz grundsätzlich optimistischer Zukunftsperspektiven äußern viele junge Menschen Sorgen um die finanzielle Lage der Familie. Fast die Hälfte macht sich häufig oder zumindest gelegentlich Gedanken über das vorhandene Geld. Etwa ebenso viele berichten, dass sie sich regelmäßig Dinge nicht leisten konnten, die Freund*innen gekauft haben. Besonders deutlich wird: Wer für Unternehmungen mit dem Freundeskreis selbst aufkommen muss, erlebt finanzielle Engpässe oft als soziale Ausgrenzung.
„Nur die Existenz abzusichern, reicht nicht“, betont Antje Funcke, Familienpolitik-Expertin der Bertelsmann Stiftung. „Kinder und Jugendliche brauchen auch finanzielle Mittel, um aktiv am sozialen Leben teilnehmen zu können.“ Das bestätigt auch das JugendExpert*innenTeam, das die Studie begleitet hat. In der Begleitbroschüre „Mit uns!“ schreiben die Jugendlichen: „Wer nicht genug Geld hat, bleibt oft zuhause – und das kann auf Dauer einsam machen.“
Teilhabe braucht neue Rahmenbedingungen
Aktuelle staatliche Leistungen wie das Bürgergeld oder das Bildungs- und Teilhabepaket greifen zu kurz, wenn es um die tatsächlichen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen geht. Die Studie plädiert daher für eine Neuausrichtung existenzsichernder Leistungen – unter Berücksichtigung sozialer und digitaler Teilhabe. Ebenso wichtig sei der systematische Einbezug junger Menschen in politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. Kinder und Jugendliche sind Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt – ihre Perspektiven müssen stärker berücksichtigt werden.
Gleichzeitig brauche es mehr kostenfreie Angebote in Bereichen wie Bildung, Freizeit, Sport und Kultur. Nur so lasse sich echte Teilhabe ermöglichen. Eine rein finanzielle Unterstützung genüge nicht – notwendig sei ein Zusammenspiel aus Geldleistungen und einer gut ausgebauten sozialen Infrastruktur.
Mitbestimmung im Schulalltag gewünscht
Auch im schulischen Umfeld äußern Kinder und Jugendliche ein starkes Bedürfnis nach Mitgestaltung. Zwar sind die meisten mit ihrer Schule grundsätzlich zufrieden, doch rund die Hälfte fühlt sich bei der Auswahl von Lerninhalten und Arbeitsmethoden nicht ausreichend beteiligt. Besonders Grundschulkinder bemängeln mangelnde Mitsprachemöglichkeiten.
Dabei ist Mitbestimmung ein entscheidender Motivationsfaktor: 95 Prozent der Befragten wünschen sich interessante Aufgaben, 94 Prozent genug Pausen und freie Zeit, und 93 Prozent eine zugängliche Lehrkraft, bei der man Fragen stellen kann.
„Kinder und Jugendliche besuchen ihre Schule nachweislich lieber, wenn sie das Gefühl haben, diese mitgestalten zu können“, erklärt Arne Halle, Schulpolitik-Experte der Bertelsmann Stiftung. Eine stärkere Beteiligung der Schüler*innen würde nicht nur die Zufriedenheit erhöhen, sondern auch das Lernen effektiver gestalten.
Zur Studie
Die Ergebnisse stammen aus einer bundesweiten, repräsentativen Befragung von 1.037 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 15 Jahren sowie einer ergänzenden Elternbefragung. Zusätzlich fanden qualitative Gruppendiskussionen mit Grundschulkindern statt. Die Studie wurde im November und Dezember 2023 von der iconkids & youth international research GmbH durchgeführt und vom Institut für soziale Arbeit e.V. Münster ausgewertet. Besonderes Merkmal: Junge Menschen waren nicht nur Teil der Befragung, sondern auch aktiv an der Konzeption und Interpretation beteiligt – ein wichtiger Schritt hin zu mehr echter Beteiligung. In der Broschüre „Mit uns!“ kommentieren einige Jugendliche die Studie:
Quelle: Pressemitteilung Bertelsmann Stiftung