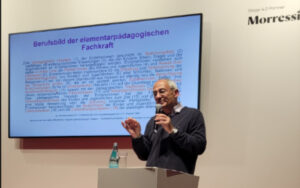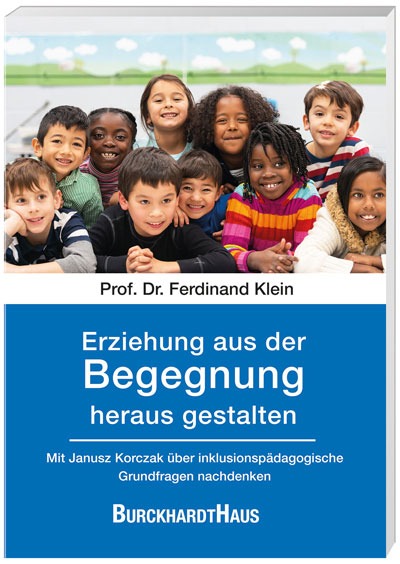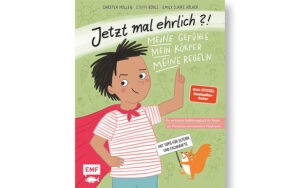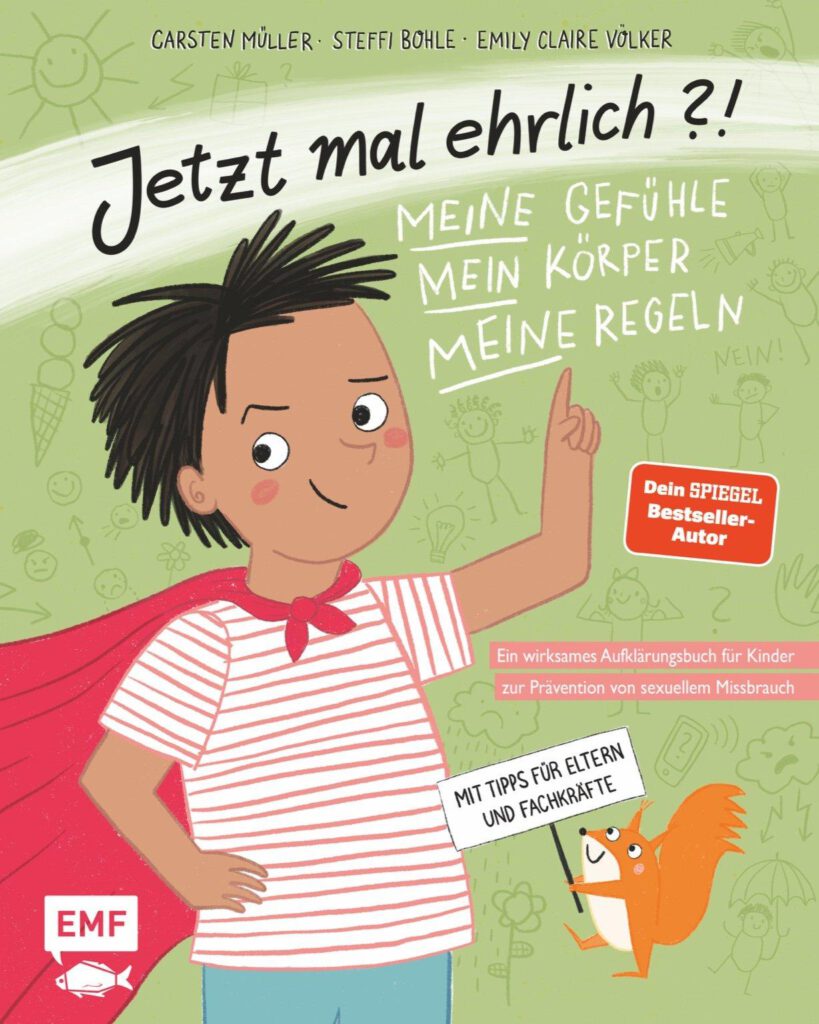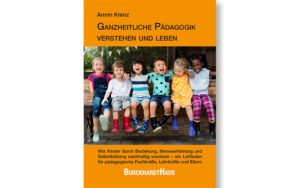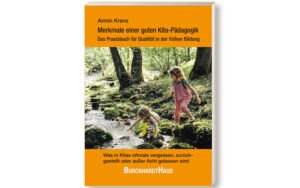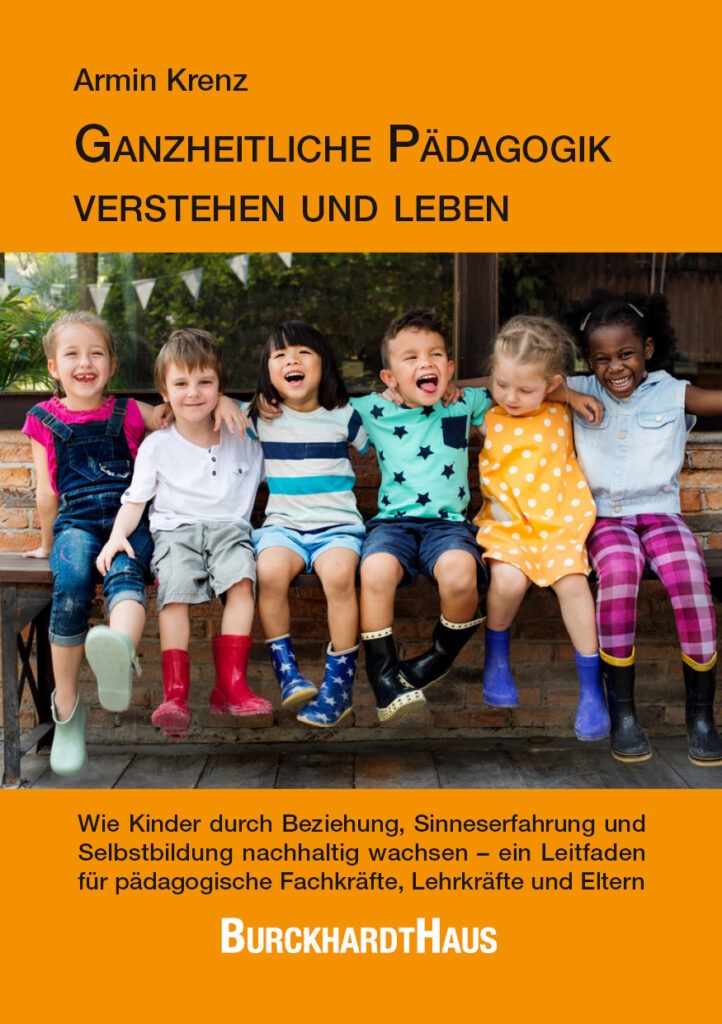didacta 2026 in Köln: Treffen, Ideen und Veranstaltungen für Fachkräfte

Mit Lesekino mit Tina Rau, Vortrag von Prof. Dr. Armin Krenz, Workshops mit Frieder Knauss und einem Geschenk für alle Leser*innen von spielen und lernen
Wenn sich vom 10. bis 14. März 2026 in Köln wieder die Tore zur didacta öffnen, richtet sich der Blick der Bildungsbranche erneut auf die traditionsreiche Messe. Die didacta gilt offiziell als Europas größte Bildungsmesse – und auch wenn sie in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz den Glanz früherer Zeiten entfalten konnte, bleibt sie doch ein zentraler Treffpunkt für pädagogische Fachkräfte, Träger, Fachverlage und Bildungsanbieter.
Gerade für Menschen aus der Frühpädagogik, der Kita-Praxis und der Elementarbildung lohnt sich ein Besuch weiterhin: Denn die didacta ist weniger ein Ort für große Inszenierungen als vielmehr eine Plattform für Austausch, Gespräche und konkrete Ideen für den Alltag in Bildungseinrichtungen.
Ein besonderer Grund, in diesem Jahr nach Köln zu kommen: spielen und lernen ist erstmals nach vielen Jahren mit einem eigenen Programm vertreten – mit Büchern, Fachimpulsen, prominenten Gästen und einer Einladung zum persönlichen Austausch.
didacta 2026: Bildung im Wandel – Frühe Bildung im Fokus
Die didacta 2026 steht unter dem Motto „Alles im Wandel. Bildung im Fokus“. Damit greift die Messe aktuelle gesellschaftliche und pädagogische Herausforderungen auf: Fachkräftemangel, Qualitätsentwicklung, Inklusion, Diversität, Kinderschutz, Sprachbildung, Digitalisierung und die Frage, wie Bildung in unsicheren Zeiten Orientierung geben kann.
Besonders deutlich wird dabei, dass Bildung nicht erst in der Schule beginnt, sondern schon in den ersten Lebensjahren. Die Frühe Bildung bildet die Grundlage für gelingende Bildungsbiografien – und genau hier setzt die didacta in Halle 8 einen Schwerpunkt.
Mehr als 600 Ausstellende präsentieren Materialien, Konzepte, Lernangebote und Dienstleistungen speziell für den Kita-Bereich. Fachkräfte können neue Produkte ausprobieren, digitale Tools testen oder innovative Raumkonzepte kennenlernen. Vor allem aber bietet die Messe Raum, um miteinander ins Gespräch zu kommen – über das, was im Alltag funktioniert, was fehlt und was Kinder heute wirklich brauchen.
spielen und lernen live in Halle 8: Stand F 015 als Treffpunkt
Wenn die didacta am 10. März startet, ist diesmal auch spielen und lernen mit dabei. Gemeinsam mit Verlagen, Autorinnen und Partnerinnen präsentiert das Team in Halle 8 am Stand F 015 ein vielseitiges Programm rund um:
- Kinder- und Bilderbücher
- pädagogische Fachliteratur
- Elternratgeber
- neue Ideen für Kita und Familie
- Materialien für selbsttätiges Lernen
Mit dabei ist auch Miralearn, das kreative Lösungen rund um eigenständige Lernprozesse und kindorientierte Bildungsarbeit vorstellt.
Der Stand soll dabei nicht nur Ausstellungsfläche sein, sondern ein Ort der Begegnung: Fachkräfte können stöbern, Fragen stellen, neue Impulse mitnehmen und mit Expert*innen ins Gespräch kommen.
🎁 Jede Leserin und jeder Leser von spielen und lernen erhält ein kleines Geschenk am Stand F 015.
Tina Rau und die Fizzli-Puzzlis: Kreative Begleitung durch die Messe

Mit Tina Rau begleitet eine bekannte Kinderbuchautorin und Erzieherin das Team von spielen und lernen während der gesamten Messezeit. Viele kennen sie durch ihre fantasievollen Geschichten und die beliebten Fizzli-Puzzlis, die spielerisch Sprache, Kreativität und emotionale Bildung verbinden.
Tina Rau wird an allen Messetagen am Stand präsent sein, für Gespräche zur Verfügung stehen und zeigen, wie Geschichten und Bilderbücher pädagogisch wirksam eingesetzt werden können – nicht als „Nebenbei-Angebot“, sondern als Schlüssel zu Beziehung, Sprache und innerer Entwicklung.
Lesekino „Kennt ihr Blauland?“ – ein besonderes Messeerlebnis
Ein Highlight erwartet Besucher*innen gleich am ersten Messetag:
Am Dienstag, 10. März 2026 von 12:00 bis 12.30 Uhr präsentiert spielen und lernen auf der Stiftungsfläche des Ausschusses Frühe Bildung im Didacta Verband (Halle 8, Stand D 044) das Lesekino:
„Kennt ihr Blauland?“ mit Tina Rau und Martin Hermann
Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Lesung, sondern um eine atmosphärische Verbindung aus Sprache, großformatigen Bildern und Musik. Die Klänge des Musikers Martin Hermann schaffen gemeinsam mit den projizierten Illustrationen einen Raum, in dem Lauschen und Schauen zusammenfinden.
Das Bilderbuch „Kennt ihr Blauland?“ gehört seit 1988 zu den Klassikern im deutschsprachigen Raum – und ist heute aktueller denn je. Es geht um Gefühle, innere Welten und die Frage, wie Kinder ihre eigenen Ausdrucksformen finden dürfen.
Nach dem rund 30-minütigen Lesekino besteht Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit der Autorin und dem Musiker.
Prof. Dr. Armin Krenz: Kinder haben ein Recht auf ihre Kindheit
Ein zweiter inhaltlicher Höhepunkt folgt am Nachmittag:
Am Dienstag, 10. März 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr hält der renommierte Sozialpädagoge und Begründer des Situationsorientierten Ansatzes, Prof. Dr. Armin Krenz, einen Vortrag mit dem Titel:
„Kinder haben ein RECHT auf ihre Kindheit – Ein Plädoyer für eine kind(heits)orientierte Elementarpädagogik“
Krenz gehört zu den bekanntesten Stimmen der Frühpädagogik. In seinem Beitrag macht er deutlich, wie sehr Kindheit heute gefährdet sein kann: durch Fremdbestimmung, Zeitdruck, getaktete Programme und den Verlust von Entwicklungsräumen.
Im Zentrum steht eine entscheidende Frage:
Was brauchen Kinder wirklich – und was muss Elementarpädagogik leisten, um ihrem Auftrag gerecht zu werden?

Prof. Dr. Krenz wird darüber hinaus von Dienstag bis Donnerstag auf der Messe anwesend sein. Am Stand von spielen und lernen gibt es Gelegenheit zum persönlichen Austausch.
Warnsignale erkennen – Kinder stärken: Workshops mit Frieder Knauss

Ebenso hält Frieder Knauss am Messestsamstag, den 14. März an unserem Stand zwei Workshops für pädagogische Fachkräfte (11 und 13 Uhr). Im Fokus steht die Frage, wie sich alarmierende Verhaltenssignale bei Kindern erkennen lassen, die auf Mobbing oder möglichen Missbrauch hinweisen – und wie Fachkräfte gezielt reagieren und vorbeugen können. Knauss ist Trainer, Mediator, Theaterpädagoge und zertifizierter Kinderschutzbeauftragter mit über 15 Jahren Erfahrung in Gewaltprävention und Resilienzförderung. In seinen praxisnahen Impulsen verbindet er Prävention, Deeskalation und Intervention mit konkreten Übungen zur Stärkung von Selbstbewusstsein, Selbstbehauptung und innerer Sicherheit bei Kindern – alltagsnah, achtsam und wirksam.
didacta 2026 mit echten Impulsen – und spielen und lernen mittendrin
Die didacta 2026 ist ein wichtiger Ort für Menschen, die Bildung gestalten. Besonders in der Frühpädagogik braucht es Räume, in denen Fachkräfte sich vernetzen, neue Ideen entdecken und inhaltliche Orientierung finden können.
spielen und lernen freut sich, Teil dieser Messe zu sein: mit Büchern, Materialien, Begegnungen und prominenten Gästen wie Tina Rau und Prof. Dr. Armin Krenz.
Besuchen Sie uns in Halle 8, Stand F 015 – entdecken Sie neue Impulse für Ihre Praxis, kommen Sie mit uns ins Gespräch und holen Sie sich Ihr kleines Geschenk als Leser*in von spielen und lernen ab.
Viele weitere Veranstaltungen im Messeprogramm
Neben den Veranstaltungen mit Tina Rau und Prof. Dr. Armin Krenz bietet die didacta während der gesamten Messezeit zahlreiche weitere Programmpunkte rund um Kita, Schule, Weiterbildung und Bildungsinnovation.
Workshops, Vorträge und Sonderschauen – etwa zu Nachhaltigkeit, Stiftungsengagement oder digitaler Bildung – können bereits vorab online gebucht werden. Oft sind es gerade die kleineren Formate und persönlichen Begegnungen, die den größten Mehrwert für den pädagogischen Alltag bieten.
Ein Blick ins offizielle Programm lohnt sich also – und Köln wird im März 2026 für einige Tage wieder zum Treffpunkt all jener, die Bildung nicht nur verwalten, sondern weiterdenken wollen.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.didacta-koeln.de/