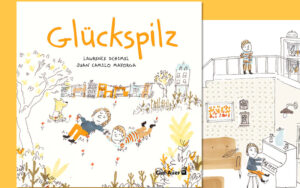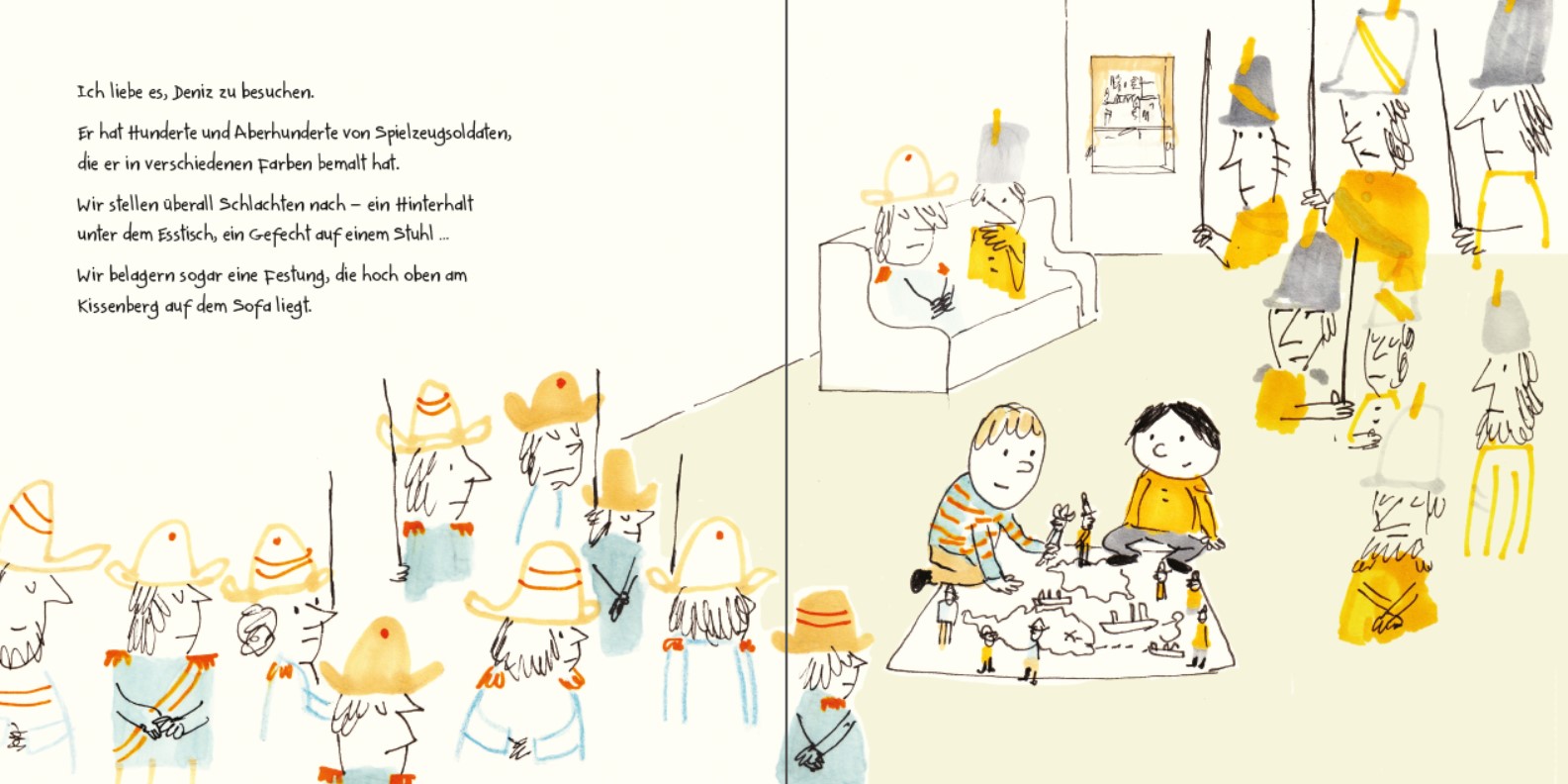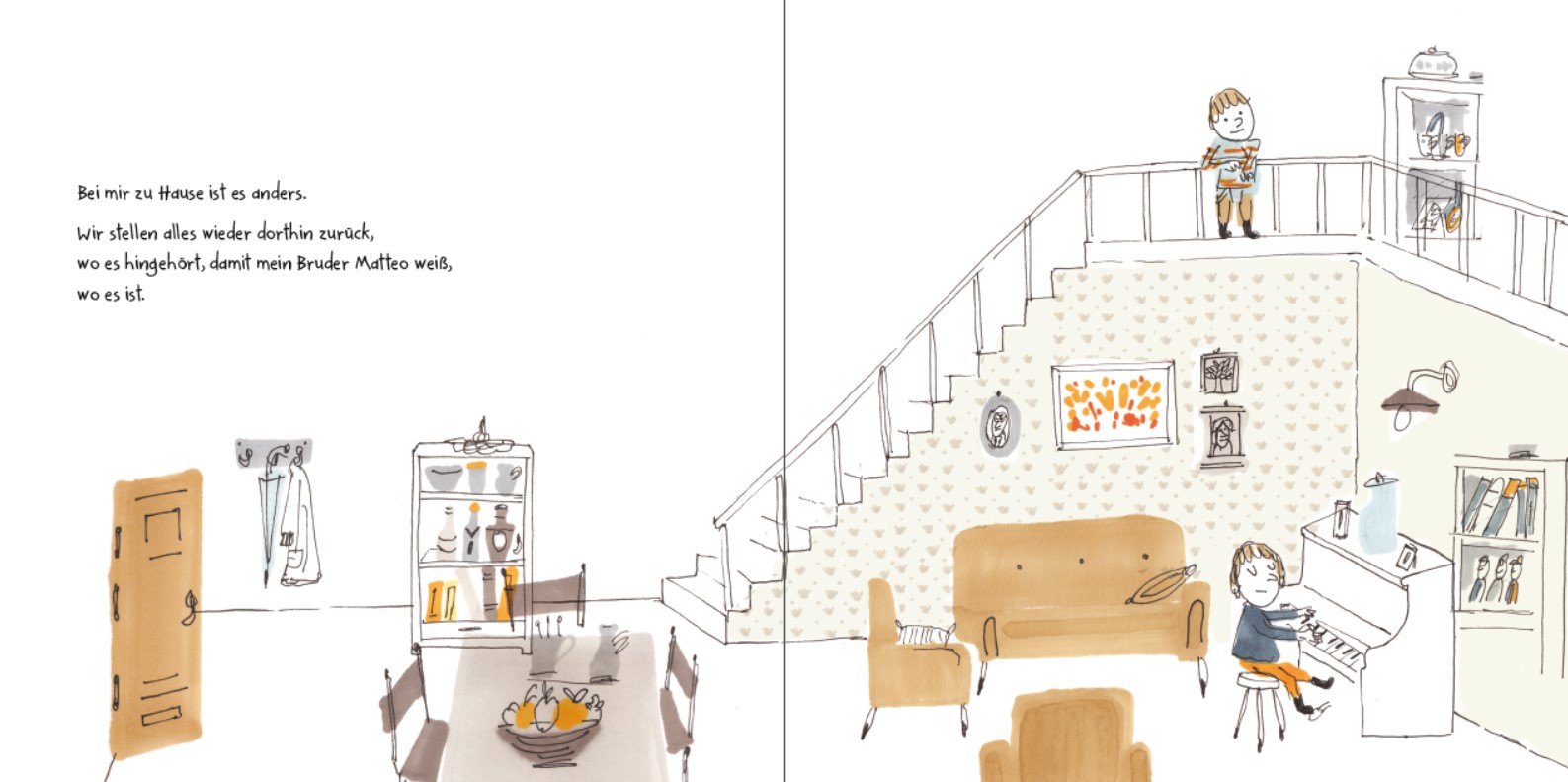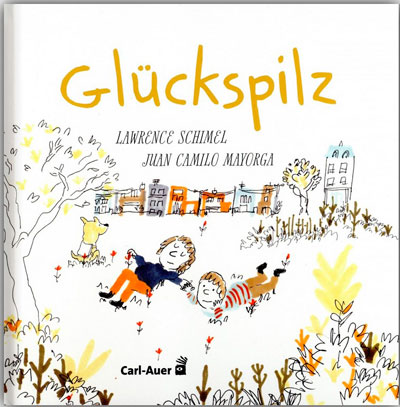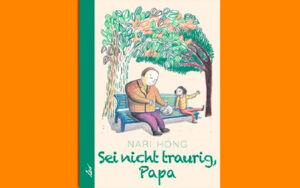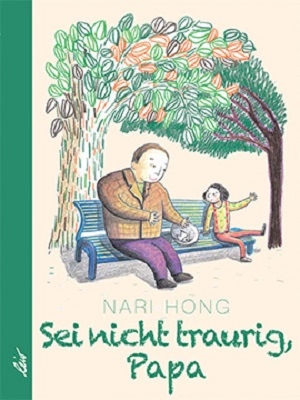Tagung zur Kindheitsforschung: Zwischen Normalisierung und Behinderung

Vom 10. bis 12. September 2025 treffen sich internationale Expertinnen und Experten in Duisburg-Essen, um über Selbstbestimmung, Vulnerabilität und Inklusion in der Kindheit zu diskutieren.
Wie lässt sich die grundsätzliche Abhängigkeit von Kindern ernst nehmen, ohne ihnen ihre Selbstbestimmung abzusprechen – insbesondere, wenn sie mit einer Behinderung leben? Diese Frage steht im Zentrum der internationalen Tagung „Exploring Vulnerability in Childhood. Between Normalization and Disablement“, die vom 10. bis 12. September 2025 an der Universität Duisburg-Essen stattfindet.
Wissenschaftlicher Austausch mit globaler Perspektive
Die Tagung bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Kindheitsforschung, den Disability Studies und der Philosophie der Kindheit zusammen. Eingeladen hat die Arbeitsgruppe Kindheitsforschung am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Duisburg-Essen. Forschende aus sieben Ländern reisen an, um sich über aktuelle Diskurse auszutauschen und neue Impulse zu setzen.
Veranstaltet von der Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Anja Tervooren, Leiterin der Arbeitsgruppe Kindheitsforschung, betont: „Die Kindheitsforschung ist gefordert, sowohl die Verletzlichkeit aller Kinder als auch ihr Recht auf Selbstbestimmung in den Blick zu nehmen. Besonders wichtig ist es, Kindheiten von als behindert verstandenen Kindern zu analysieren, um Kindheit insgesamt besser zu verstehen.“ Sie verweist dabei auf die englischsprachige Forschung, die hierzulande bislang nur unzureichend rezipiert werde.
Keynotes, Panels und Poster – ein vielfältiges Programm
Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Tagung findet im Glaspavillon am Campus Essen statt. Neben Keynotes aus Kanada, Großbritannien und Deutschland sind drei thematische Panels geplant, in denen aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt werden. Eine Posterausstellung ergänzt das Programm.
Politik und Praxis im Blick
Ein besonderer Programmpunkt ist die Podiumsdiskussion mit Bezug auf aktuelle politische Entwicklungen – insbesondere zum Zusammenspiel von Forschung und Elterninitiativen in Großbritannien. Prof. Tervooren sieht darin ein mögliches Vorbild für andere Länder.
Weitere Informationen zur Tagung und zum Programm finden sich demnächst auf der Website des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Duisburg-Essen. Die Veranstaltung richtet sich an Fachpublikum, Promovierende, Studierende und Interessierte aus Wissenschaft, Praxis und Politik.
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.uni-due.de/biwi/kindheitsforschung/exploringvulnerablity.php