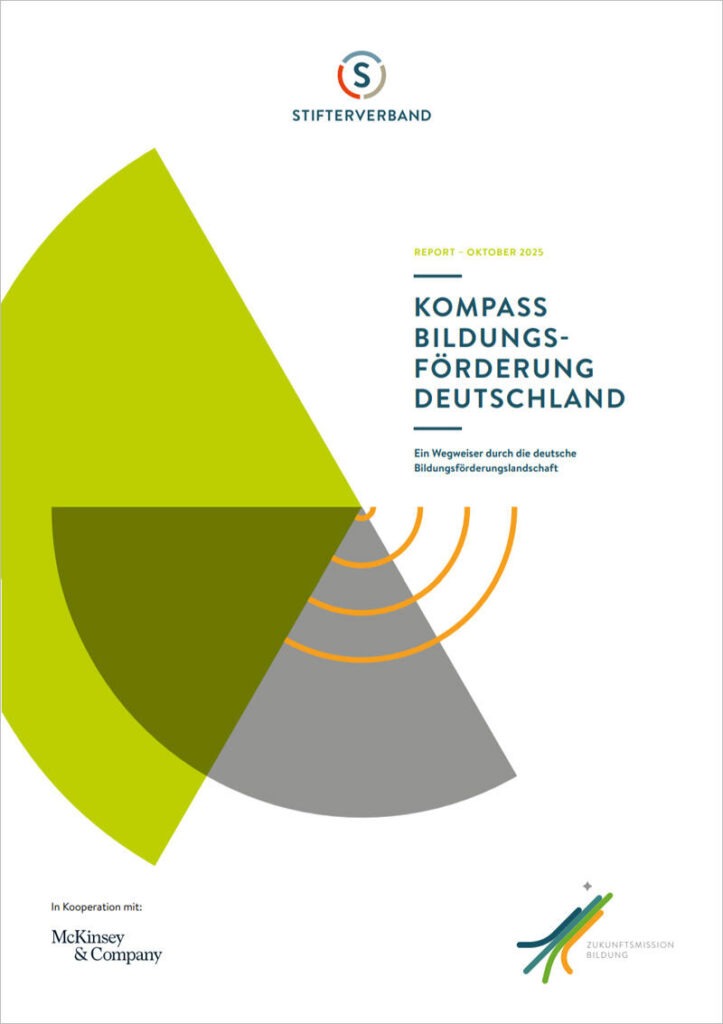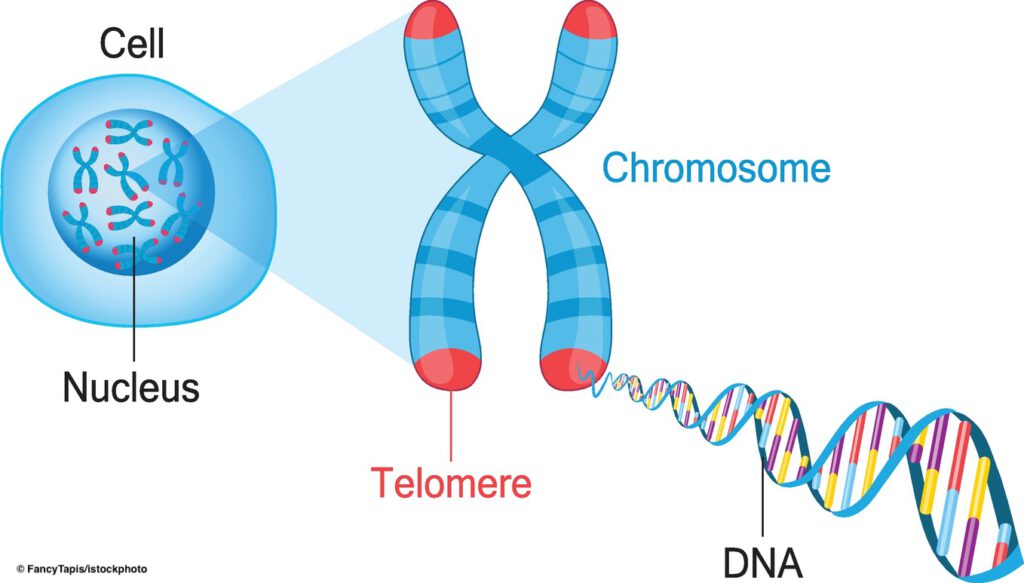Neue Studien zeigen: Sprachkompetenz ist der wichtigste Faktor für den Bildungserfolg – doch Personalmangel und fehlende Ressourcen erschweren die Förderung in Kitas und Schulen.
Sprache öffnet Türen – zu Bildung, Teilhabe und einem gelingenden Lebensweg. Der Bildungsmonitor 2024 macht deutlich: Fehlende Deutschkenntnisse sind zusammen mit einer geringen elterlichen Bildung einer der stärksten Risikofaktoren für schulisches Scheitern. Besonders betroffen sind Kinder aus zugewanderten Familien, die zu Hause selten Deutsch sprechen oder deren Eltern selbst noch Deutsch lernen müssen.
Früh starten – bevor die Schule beginnt
Schon im Kindergartenalter zeigen sich Unterschiede im Wortschatz und Sprachverständnis. Kinder mit Migrationshintergrund besuchen zudem seltener eine Kita: 2022 waren es nur 78 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen, während es bei Kindern ohne Migrationshintergrund fast 100 Prozent waren. Fachleute betonen daher, wie entscheidend frühe Sprachförderung ist. Vorschläge reichen von verpflichtenden Sprachstandstests mit vier Jahren bis hin zur Einführung einer Kita-Pflicht.
Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) betonte im Sommer 2024 mit Blick auf den Bildungsmonitor: „Sprache ist der Schlüssel, um in der Schule erfolgreich zu sein. Und wir müssen dort viel früher ansetzen. Erstklässlerinnen und Erstklässler sollten schon im Zug sitzen und nicht nur die Rücklichter sehen.“
Personalmangel gefährdet Sprachbildung
Gleichzeitig verschärft sich der Fachkräftemangel in Kitas dramatisch. Die DKLK-Studie 2024 zeigt: 83 Prozent der Kitaleitungen berichten von weiter zunehmender Unterbesetzung, viele Teams arbeiten mit einem hohen Anteil nicht ausgebildeter Kräfte. Besonders die sprachliche Bildung leidet darunter – mehr als 40 Prozent der Einrichtungen in Bayern verfügen über keine einzige Fachkraft, die speziell für Sprachförderung qualifiziert ist.
BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann warnte im Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses 2024 eindringlich: „Schon bisher war der Personalmangel dramatisch und jetzt nimmt er weiter zu. Top-qualifiziertes pädagogisches Personal arbeitet bis zur Belastungsgrenze – und kann den Kindern trotzdem nicht gerecht werden.“
Klassenzimmer im Spannungsfeld
Die INSM-Studie betont, dass sich Sprachdefizite nicht nur auf einzelne Kinder auswirken, sondern ganze Klassen betreffen können. Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, sagte bei der Vorstellung des Bildungsmonitors 2024: „Wenn Sie mehr als die Hälfte Kinder in der Klasse haben, die nicht deutsch sprechen, dann kriegen die nichts mit – und es ist auch schlecht für alle anderen. Das schlechte Niveau der einen zieht das Bildungsniveau der anderen mit runter.“
Gleichzeitig zeigt die Forschung, dass Migrationshintergrund allein kein Nachteil sein muss. Marcel Helbig, Soziologe am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, erklärte im Kontext der Bildungsmonitor-Ergebnisse: „In den Familien, in denen Deutsch gesprochen wird und die Eltern bildungsaffin sind, haben die Kinder keine Probleme. Im Gegenteil: Bei gleichen Kompetenzen gehen Migrantenkinder in Deutschland häufiger aufs Gymnasium, weil sie höhere Aspirationen haben.“
Mehrsprachigkeit als Ressource nutzen
Neben der Förderung der deutschen Sprache rückt auch die Wertschätzung von Mehrsprachigkeit stärker in den Fokus. In vielen Kitas werden Kinder nach wie vor ermahnt, ihre Muttersprache nicht zu sprechen. Dabei sehen Expertinnen und Experten gerade hier ein großes Potenzial.
Ilka Maserkopf, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen, forderte im Herbst 2024 mehr gesellschaftliche Anerkennung:
„Wir müssen die Ressourcen, die sich durch Mehrsprachigkeit bieten, besser wertschätzen. In einigen Kitas wird Kindern sogar verboten, ihre Muttersprache zu sprechen – dabei könnten wir als Gesellschaft enorm von Mehrsprachigkeit profitieren.“
Politische Programme – Tropfen auf den heißen Stein?
Mit dem „Startchancen-Programm“ wollen Bund und Länder bis 2026 rund 4.000 Schulen in schwieriger Lage unterstützen. Doch Forschende bezweifeln, dass das reicht: Viel zu wenige Kinder würden erreicht.
Auch Tomi Neckov, stellvertretender Bundesvorsitzender des VBE, kritisierte beim Deutschen Kitaleitungskongress 2024 eine Fehlentwicklung: „Ein Kita-Abitur, mit dem nicht-deutschsprachige Kinder abgestraft würden, darf es nicht geben. Jedes Kind muss eingeschult werden. Über Sprachstandstests hinaus brauchen wir praktische Maßnahmen und ausreichend Fachkräfte.“
Was pädagogische Fachkräfte brauchen
Die Botschaft der Studien ist eindeutig: Ohne ausreichend Personal und eine früh ansetzende, kontinuierliche Sprachförderung lassen sich die Bildungsunterschiede nicht schließen. Pädagogische Fachkräfte sehen sich täglich mit steigenden Anforderungen, aber auch mit wachsender Verantwortung konfrontiert. Sie brauchen:
- Verlässliche Fachkräfteoffensiven und attraktivere Arbeitsbedingungen,
- multiprofessionelle Teams, die Sprachbildung in den Alltag integrieren,
- mehr Zeitressourcen, um Kinder individuell fördern zu können,
- und eine gesellschaftliche Aufwertung von Mehrsprachigkeit.
Sprache ist und bleibt der Schlüssel für Chancengerechtigkeit. Damit Kinder beim Schuleintritt wirklich im „Zug sitzen“ – und nicht nur die Rücklichter sehen – braucht es mehr als politische Absichtserklärungen: Es braucht konkrete, flächendeckende Investitionen in Sprachförderung und pädagogisches Personal.