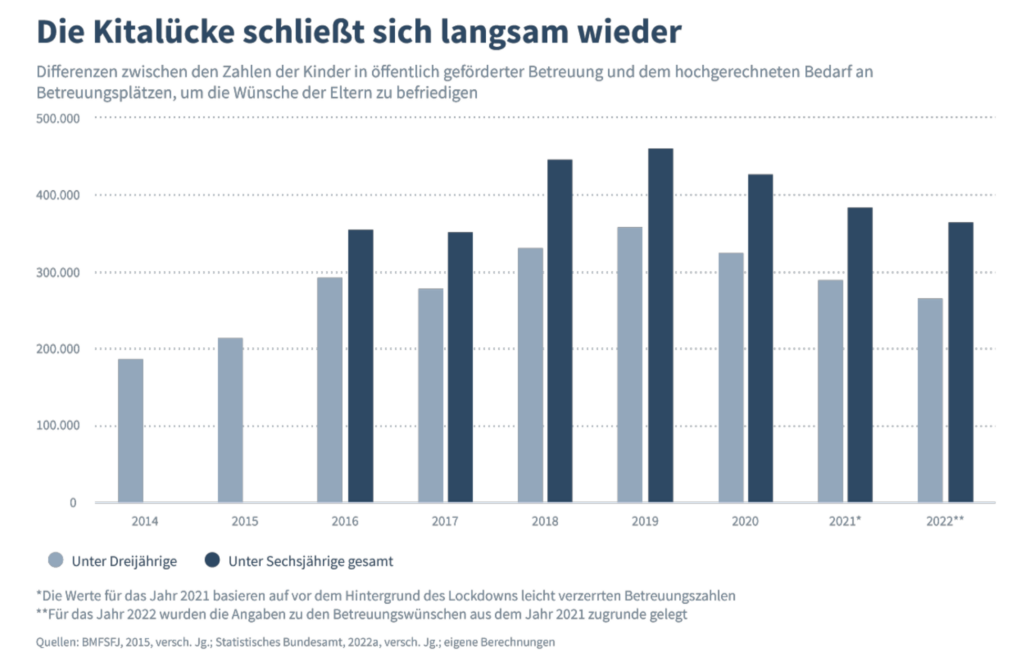Schlusslicht bei der Inklusion: Baden-Württemberg vor der Bildungswahl 2026

Freiburger Initiativen fordern konsequente Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – Wahljahr als Chance für echten Wandel
Von außen betrachtet wirkt Baden-Württemberg modern, wirtschaftsstark und bildungspolitisch gut aufgestellt. Doch wenn es um schulische Inklusion geht, ist das „Ländle“ bundesweit Schlusslicht. Das belegt die Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und der Bertelsmann Stiftung des Soziologen Sebastian Steinmetz und anderer (2021) zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in den Bundesländern. In keinem einzigen der geprüften Kriterien erfüllte Baden-Württemberg seinerzeit die Vorgaben von Artikel 24 UN-BRK. Seither hat die Grün-Schwarze Landesregierung unter der Leitung des Ministerpräsidenten und langjährigen Gymnasiallehrers Winfried Kretschmann nur wenig getan.
Dabei gibt es seit dem 1. August 2015 ein „inklusives Schulgesetz“. Die Sonderschulpflicht wurde abgeschafft, Kinder mit Behinderungen dürfen theoretisch jede allgemeine Schule besuchen. In der Praxis funktioniert das jedoch selten. Viele Eltern berichten von fehlenden Ressourcen, überlasteten Lehrkräften, mangelnder Unterstützung sowie Diskriminierung und Mobbing. „Wir sprechen mit Eltern, die alles versucht haben, um ihr Kind in einer Regelschule zu halten – und am Ende doch aufgeben“, sagt Simone Ruser, Vorstandsmitglied von buntes wir e.V.. „Sie sind frustriert, weil das Versprechen von Inklusion in Baden-Württemberg oft nur auf dem Papier steht.“
Wir sprechen mit Eltern, die alles versucht haben, um ihr Kind in einer Regelschule zu halten – und am Ende doch aufgeben.
– Simone Ruser
„Ein Menschenrecht, das eingeklagt werden könnte“
Dass Inklusion in Baden-Württemberg noch so unzureichend umgesetzt ist, kann Eckhard Feige, Inklusionspädagoge und ehemaliger Schulleiter aus Bremen, kaum fassen. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Bremen heute als Vorreiter der schulischen Inklusion gilt. „Alle Argumente und Bezüge zur UN-Konvention, die die Initiativen in Baden-Württemberg vortragen, sind absolut richtig. Tragisch ist nur, dass diese Debatte dort – wie auch in Bayern – noch keinen nennenswerten Niederschlag in der Schulrealität gefunden hat.“
Dass sich eine Landesregierung diesem Auftrag seit so vielen Jahren verweigert, ist beschämend. Es ist nicht nur ein Versäumnis – es ist eine Missachtung der Rechte von Kindern und Jugendlichen.
— Eckhard Feige
Feige verweist auf den klaren rechtlichen Rahmen: „Der Anspruch auf inklusive Bildung ist laut UN-Konvention ein Menschenrecht – und könnte im Grunde eingeklagt werden. Dass sich eine Landesregierung diesem Auftrag seit so vielen Jahren verweigert, ist beschämend.“
Wahljahr 2026: Druck auf die Parteien steigt
Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Für die Freiburger Initiative „buntes wir e.V.“ der perfekte Zeitpunkt, um den Parteien klare Forderungen vorzulegen. Der zehn Punkte umfassende Katalog reicht vom Moratorium für den Neubau von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) über verbindliche Reduktionsziele für die Segregationsquote bis zur verpflichtenden Aufnahme inklusiver Unterrichtsinhalte in Lehramtsstudiengänge.
„Wir wollen der Finger in der Wunde der Bildungspolitiker im The Länd sein“, betont Ruser. „Wir haben genug von unverbindlichen Bekenntnissen. Jetzt ist der Moment, dass sich im Wahlkampf alle Kandidatinnen und Kandidaten klar zur UN-BRK bekennen – mit konkreten Schritten und einem verbindlichen Zeitplan.“
Wir fordern ein klares Bekenntnis zur UN-BRK / Artikel 24 inklusive dem dort geforderten Rückbau von segregativen Schulformen.
— Forderungspapier buntes wir e.V.
Besonders kritisch sieht die Diplom-Volkswirtin den oft beschworenen „Elternwunsch“ als Argument für den Fortbestand zweier getrennter Schulsysteme: „Das ist eigentlich gar kein Wunsch, sondern eine Notlösung. Die Eltern dürfen sich zwischen einem gut ausgestatteten Förderschulsystem und einer Inklusion entscheiden, die in vielen Schulen schlicht nicht umgesetzt wird.“
Beispiele, die wütend machen
Ein aktueller Streitpunkt ist der geplante Neubau eines neuen SBBZ in Niederrimsingen für rund elf Millionen Euro. „Ich habe noch nie davon gehört, dass so viel Geld in inklusive Bildung investiert wurde“, sagt Ruser. „Das ist wieder eine verpasste Chance. Statt Barrieren abzubauen, werden neue Mauern hochgezogen.“
Feige macht deutlich, dass es auch anders geht: „In Bremen haben wir seit der Schulgesetznovelle 2009 konsequent Förderschulen abgebaut – von 25 blieben nur drei spezialisierte Förderzentren. Neue Förderschulen werden nicht errichtet. Alle anderen Kinder lernen gemeinsam im Regelsystem – mit individueller Förderung.“
Neue Förderschulen werden bei uns auf gar keinen Fall errichtet – jeder Euro fließt in den gemeinsamen Unterricht.
— Eckhard Feige
Noch ein alarmierender Befund: Über 60 Prozent der Kinder in Freiburg mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben einen Migrationshintergrund. „Das steht schwarz auf weiß im Schulentwicklungsbericht der Stadt“, so Ruser. „Hier werden Kinder ‚behindert‘ gemacht, statt sie gezielt zu fördern. So beginnt oft eine lebenslange Kette der Ausgrenzung – bis hin zur Werkstatt für Menschen mit Behinderung.“
„Inklusion ist kein Luxus“
Auch Cornelia Bossert von der Initiative Inklusion neu denken spricht Klartext: „Inklusion ist kein Extra, sondern eine Investition in eine starke, kreative und gerechte Gemeinschaft, von der jeder profitiert. Je vielfältiger eine Gruppe, desto reicher die Ideen, desto größer die Lösungskompetenz.“
Inklusion ist kein Extra, sondern eine Investition in eine starke, kreative und gerechte Gemeinschaft.
— Cornelia Bossert
Sie verweist auf die wirtschaftlichen Vorteile einer inklusiven Gesellschaft: „Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Menschen mit Behinderung sind oft motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte, die wir uns nicht leisten können zu übersehen. Inklusion ist also auch eine kluge wirtschaftliche Entscheidung.“
Für Bossert ist Inklusion ein Lackmustest für die Demokratie: „Eine inklusive Gesellschaft ist wie ein großer Tisch, an dem jeder Platz hat – egal, ob mit oder ohne Behinderung, egal welcher Herkunft, Religion oder Lebensweise. Wenn wir diesen Anspruch nicht im Schulsystem umsetzen, schwächen wir unsere Gesellschaft von innen.“
Hürden in Köpfen und Strukturen
Die Aktivistinnen sehen die Ursachen für die Misere in einem Zusammenspiel aus fehlender Betroffenheit in der Mehrheitsgesellschaft, stereotype Vorstellungen, mangelnde Sanktionen bei Diskriminierung und hohen bürokratischen Hürden. „Ohne gesellschaftlichen Druck, klare Zielvorgaben und den Mut, das Schulsystem strukturell zu verändern, bleibt es beim Inklusions-Blabla“, warnt Ruser.
In Bremen gehört individuelle Förderplanung für alle Schüler*innen zum Standard – unabhängig davon, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt oder nicht. Das ist kein ‚Luxus‘, sondern schlicht professionelle Pädagogik.
— Eckhard Feige
Feige ergänzt: „Bremen hat gezeigt, dass Wandel möglich ist – wenn der politische Wille da ist und alle Ebenen, von der Universität bis zur Schulbehörde, konsequent auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.“
Wahl 2026: Die Stunde der Wahrheit
Die Freiburger Initiativen Inklusion neu denken, buntes wir, Freiburger Bündnis – Eine Schule für alle und der Grundschulverband Baden-Württemberg bündeln ihre Kräfte, um die Landtagswahl 2026 zu einem Wendepunkt zu machen.
„Wir werden alle Parteien daran messen, ob sie sich klar für die Umsetzung der UN-BRK und den Rückbau segregierender Schulformen positionieren“, kündigt Ruser an. „Die Wählerinnen und Wähler, die sich für eine inklusive Gesellschaft einsetzen, werden genau hinschauen – und wir werden nicht locker lassen.“
Bossert ergänzt: „Wahlkampf ist immer auch ein Wettbewerb der Visionen. Wir wollen, dass Inklusion in Baden-Württemberg endlich nicht mehr als Kostenfaktor, sondern als Zukunftsinvestition begriffen wird.“
Jetzt, so sind sich die Aktivistinnen einig, sei der Moment, in dem die Weichen gestellt werden: Entweder bleibt Baden-Württemberg Schlusslicht in Sachen schulischer Inklusion – oder es wird Vorreiter. „Am 8. März 2026 haben die Menschen im Land die Möglichkeit, mit ihrer Stimme zu zeigen, wie wichtig ihnen die Rechte aller Kinder sind“, sagt Ruser. „Diese Chance sollten wir nicht verpassen.“
Gernot Körner