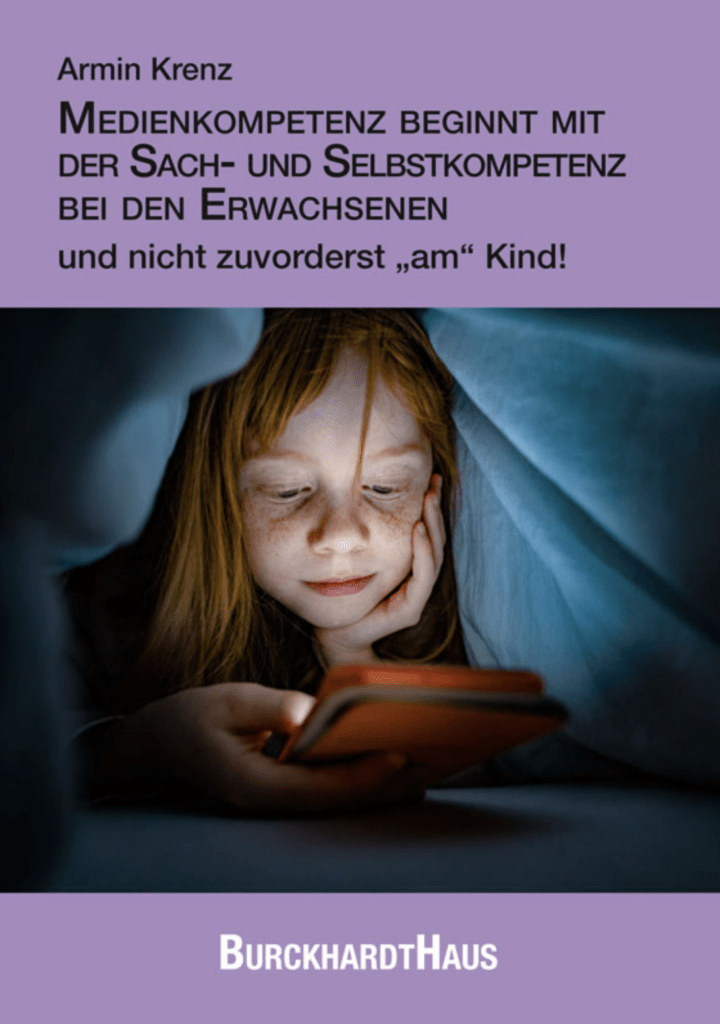Smartphone-Verbot Schule: Mehrheit will klare Altersgrenzen
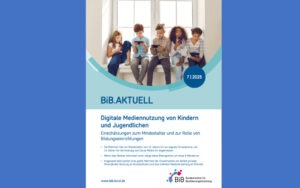
Neue Studie zeigt: Erwachsene befürworten Handyverbote an Schulen und fordern spätere Social-Media-Nutzung für Kinder – Welche Altersgrenzen Erwachsene empfehlen
Eine neue Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) zeigt, welche Regeln sich Erwachsene für Kinder wünschen:
- Eigenes Smartphone: ab 12 Jahren
- Social Media: ab 14 Jahren
- Smartphone-Verbot Schule: an Grundschulen sowie ein Nutzungsverbot im Unterricht
„Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass Erwachsene ein Schutzbedürfnis für Kinder und Jugendliche sehen – gerade bei sozialen Medien“, erklärt Prof. Dr. C. Katharina Spieß, Direktorin des BiB.
Informationen verändern die Meinung
Ob Befragte über Chancen oder Risiken digitaler Medien informiert wurden, hatte direkten Einfluss auf ihre Antworten. Wer die Risiken wie Cybermobbing oder ungeeignete Inhalte vor Augen geführt bekam, sprach sich für ein durchschnittlich vier Monate höheres Mindestalter aus.
„Information wirkt“, fasst Mitautorin Dr. Sophia Schmitz zusammen. „Insbesondere, wenn die Risiken hervorgehoben werden, erhöht sich die Altersgrenze für eine eigenständige Nutzung digitaler Medien.“
Smartphone-Verbot Schule: Mehr als ein Handyverbot
Die Mehrheit der Erwachsenen befürwortet nicht nur ein Smartphone-Verbot an Schulen, sondern erwartet auch, dass Politik und Plattformbetreiber mehr Verantwortung übernehmen.
„Ein reines Handyverbot reicht nach Ansicht vieler Befragter nicht aus“, betont Spieß. Schulen sollen Kinder und Jugendliche befähigen, verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen und Medienkompetenz zu entwickeln.
Politische Bedeutung
Für die Forschenden sind die Ergebnisse ein Signal: „Erkenntnisse über den Effekt von Information auf Einstellungen können wertvolle Ansatzpunkte für politische Entscheidungen liefern“, so Spieß. „Etwa bei der Akzeptanz potenzieller Regelungen zu einem ‚digitalen Volljährigkeitsalter‘.“
Hintergrund zur Studie
Die Befragung basiert auf einer bundesweiten Stichprobe von 1.312 Erwachsenen. Im Rahmen eines „Surveyexperiments“ erhielten die Teilnehmenden unterschiedliche Informationen zu Chancen und Risiken digitaler Medien und gaben anschließend ihre Einschätzungen zu Altersgrenzen ab.
Originalpublikation:
Schmitz, Sophia; Spieß, C. Katharina; Düval, Sabine; Hübener, Mathias; Siegel, Nico: Digitale Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. In: BiB.Aktuell 7/2025
https: www.bib.bund.de/Publikation/2025/BiB-Aktuell-2025-7

Digitale Mediennutzung: Verantwortung von Eltern und Fachkräften
Kinder wachsen mit digitalen Medien auf – zu Hause, in Kita und Schule. Die digitale Mediennutzung Kinder stellt Eltern und pädagogische Fachkräfte vor neue Aufgaben: Sie müssen Chancen und Risiken abwägen, Orientierung geben und Regeln entwickeln. Entscheidend ist, welche Inhalte in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt sinnvoll sind. Neue Schwerpunkte in der Elementarpädagogik erfordern daher immer eine sorgfältige Betrachtung.