Wie lernen wirklich funktioniert
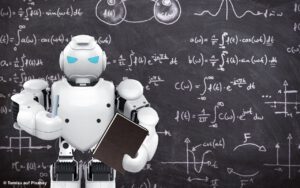
Henning Beck: Das neue Lernen heißt Verstehen
Eltern und Kinder, Auszubildende und Studenten suchen nicht erst in Zeiten der Pandemie nach dem „richtigen“ also dem effektiven Lernen. Die Angebote sind vielfältig. Sie versprechen bessere Konzentrationsmöglichkeiten und Gedächtnisleistungen. Das soll alles fast mühelos geschehen. Gute Noten garantiert. Da kommt Henning Beck mit seinem Buch „Das neue Lernen heißt Verstehen“ scheinbar genau richtig, um Unterstützung anzubieten.
Wie das Gehirn arbeitet
Der Biochemiker und Neurowissenschaftler lässt uns in die Verarbeitung des Gehirns blicken und erklärt dessen Möglichkeiten. Dabei zeigt er die Unterschiede zwischen einem menschlichen Gehirn und der künstlichen Intelligenz. Denn so einfach lässt sich ein menschliches Gehirn nicht mit zwei Zuständen (1 und 0) imitieren. Hier holt er uns aus unseren oft sciencefictionhaft geprägten Vorstellungen und zeigt uns die Grenzen, die nicht einfach und manchmal gar nicht überschritten werden können.
Vom Lernen und Verstehen
Und das Lernen? Wie helfen all die tollen Angebote? Auch hier ist genaues Hinsehen angezeigt. Jetzt beginnt Beck uns den Unterschied zwischen Lernen und Verstehen zu erklären. Lernmethoden für das Memorieren von Vokabeln oder Formeln sind nicht das Gleiche, wie zu verstehen, was eigentlich passiert und welche Zusammenhänge vorliegen.
Daher unterscheidet er auch das Lernen auf eine Prüfung und das Lernen/Verstehen von Problemen und deren Lösungen. Dieses Wissen, das wir nicht einfach bei all den datengefütterten Internetwissenspools abfragen können, muss selbst aufgebaut werden. Und genau hierin unterscheidet sich das Lernen, das die Anbieter auf dem Nachhilfemarkt und die mittlerweile massiv im Internet beworbenen Hilfen mit eigentlich altbekannten Methoden unterstützen können, vom Verstehen. Die effektivsten Methoden zum Lernen stellt Henning Beck vor und die allermeisten von uns sollten diese sogar aus der Schule noch kennen. Wiederholungen, Zusammenfassungen, Eselsbrücken, Schaubilder und eine Selbst-Abfrage sind nun mal genau das, was schon unsere Lehrkräfte einsetzten.
Zusammenhänge verstehen, Orientierung schaffen
Aber damit begnügt sich Beck eben nicht und das aus gutem Grund. Er zeigt, wie wichtig das Verständnis von Zusammenhängen und damit ein gutes Allgemeinwissen ist. Er erklärt die Bedeutung einer guten Orientierung in dem Überangebot von Informationen. Dabei wird deutlich, wie sehr wir „Schule“ brauchen. Aber welche?
Auch da zeichnet Beck ein klares Bild. Schüler und Schülerinnen brauchen keine kleinschrittigen vorzerstückelten Unterrichtseinheiten. Denn „je passiver man ist, desto schlechter versteht man.“ (S. 200). Auch den aktuell oft angewendeten „umgedrehten Unterricht“, indem sich die Lernenden nun die Inhalte per Videoerklärung selbst erarbeiten, nachdem ihnen die Lehrenden die Seiten vorher herausgesucht haben, schickt Beck auf den Prüfstand und kommt zu dem Schluss, dass es sich dabei nicht um die Lösung handelt.
Die wahre Kunst…
Die wahre Kunst liegt darin, Problemstellungen zu offerieren, die im Setting der Gruppe erstmal herausfordern, die neues Denken aktivieren und die auch ein Scheitern mit sich bringen dürfen. Doch dann muss dieses Scheitern aufgefangen werden.
…und die Rolle des Lehrenden
Die Rolle des Lehrenden bleibt somit eine sehr entscheidende. Denn er muss die Problemstellung zunächst erstellen. Diese darf nicht banal sein. Denn Wissen sollte „nicht zu leicht konsumierbar“ (S. 216) sein. Beck gibt der Rolle des Unterrichtenden damit eine Dimension, die aktuell gelegentlich in der Diskussion zwischen „LehrerIn“ und „LernbegleiterIn“ in den Hintergrund tritt. Er bevorzugt nicht den einen oder anderen Begriff, sondern er setzt auf die Aufgaben. So sind gute Unterrichtende daran zu erkennen, dass auch Lehrkräfte voneinander lernen, ihre Lehrmethoden permanent hinterfragen und sich in ihrem Unterrichtsverhalten beurteilen lassen (S. 230). Dinge, die bei uns in den Schulen und Universitäten noch nicht zur alltäglichen Routine gehören.
Die digitalen Medien
Natürlich geht der Autor auch auf die aktuelle höchst priorisierte Frage nach den digitalen Medien im Unterricht ein. Und auch hier analysiert er klar. Einmal wissen wir, aber auch die Lehrenden und deren Verwaltungsapparat darüber viel zu wenig. Zudem sind die Effekte eher dürftig, wenn der Grundtenor des Unterrichtens nicht hinterfragt wird.
Verstehen entsteht durch Testen und Abfragen (weil Wissen benötigt wird). Das Einordnen und Pausen (damit Wissen sich festigen kann) sind nötig. Vertiefung durch aktives Erklären, Fehler nutzen und den Austausch in der Gruppe (S.222) gehört dazu. Das kann durch digitale Medien unterstützt werden. Aber sie sind dafür nicht zwingend nötig und schon gar kein Ersatz.
E-Bildung to go
An dieser Stelle führt er uns in die Zukunft mit einer sich entwickelnden analog gebildeten Elite gegenüber der E-Bildung to go, die alle „Fast Food“-artig quasi an jeder Ecke kostengünstig erhalten können. Und weil in dieser digitalen Welt viel gespielt wird, räumt er auch damit auf, dass das Spiel immer ein auf Punkte und Wettbewerb ausgerichtetes sein muss, um einen Beitrag zum Lernen leisten zu können.
Ahnungslosigkeit macht Meinungsbildung offenbar leichter
Ein sehr lesenswertes Buch nicht nur für alle mit Bildung beschäftigten. Aber noch wichtiger ist der Austausch darüber untereinander und das Nutzen der bisher gemachten Fehler. Das Problem ist längst gestellt, die Irrtümer massiv begangen. Nur leider scheint uns der Lehrende zu fehlen, den die Lernenden nach ihren Irrtümern zu Hilfe holen können. So wurschteln wir weiter, wie die befragten Lehrkräfte auf S. 219f, die zwar keine Ahnung haben, sich aber dennoch eine Meinung bilden. Upps! Wann ist uns das denn passiert, dass wir so ahnungslos agieren und es als Wissen deklarieren? Vermutlich in dem Unterricht, der uns nur vorgekautes kleinschrittig vermitteltes Wissen geliefert hat und uns nie Probleme präsentierte, an denen wir auch scheitern durften und weil wir nicht gelernt haben auch Fachfremde in unsere Lösungssuche einzubinden, sondern satt interdisziplinär zu agieren, den Fachspezialisten überhöhen. Umdenken ist also unsere wichtigste Aufgabe!
Daniela Körner
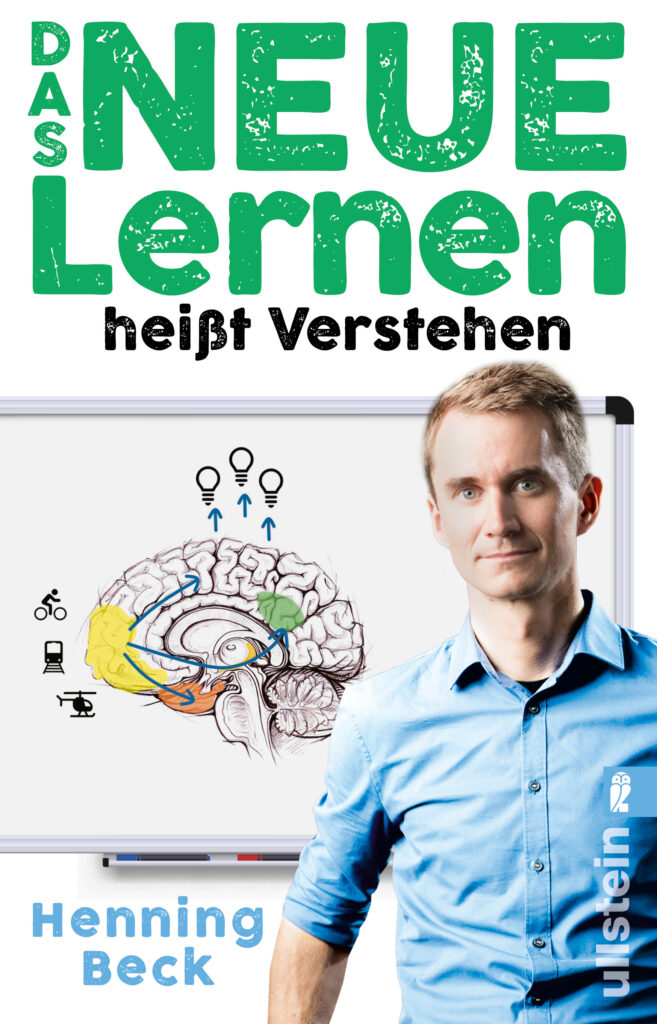
Henning Beck
Das neue Lernen heißt Verstehen
Taschenbuch, 272 Seiten
Ullstein 2021
ISBN 978-3-548-06457-4
9,99 Euro




