Frauen und Männer wollen die bezahlte Elternzeit gleichmäßig aufteilen
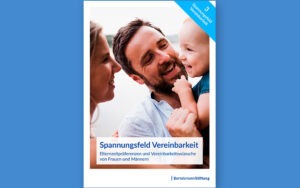
Frauen und Männer bevorzugen eine gleichmäßige Aufteilung der Elternzeit mit sieben Monaten je Partner:in
Das zeigt eine repräsentative Befragung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Gelebte Praxis ist allerdings derzeit noch das traditionelle Modell: Frauen beziehen im Schnitt 11,6 Monate Elterngeld, Männer nur 2,8 Monate. Denn bisher ist der volle Elterngeldanspruch bereits bei zwei Partnermonaten ausgeschöpft. Daher schlagen die Expert:innen eine Ausweitung der bislang zwei im Gesetz vorgesehenen Partnermonate auf mindestens vier Monate und eine Anhebung des Elterngeldes vor. Eine solche Reform entspricht nicht nur den Vorstellungen der Frauen und Männer. Sie lindert auch den Fachkräftemangel und verbessert damit die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.
46 Prozent der Väter beziehen Elterngeld – und damit immerhin doppelt so viele wie vor 15 Jahren. Aber drei Viertel von ihnen nehmen nur die zwei Partnermonate, mit denen der volle Elterngeldanspruch ausgeschöpft werden kann. Dabei entspricht das nicht den Vorstellungen der Mehrheit: In einer repräsentativen Befragung der Bertelsmann Stiftung sollten die befragten Frauen und Männer ihr bevorzugtes Modell angeben. Dabei gewinnt das egalitäre Modell, in dem beide sieben Monate Elternzeit nehmen: 44 Prozent aller Befragten sagen, dass sie eine gleichmäßige Verteilung der Elternzeit bevorzugen. Dahinter folgt mit knapp 39 Prozent die traditionelle Aufteilung (Mutter: 12 Monate, Vater: 2 Monate).
Bei der Elternzeit sind Männer und Frauen sich einig: Beide sollten sieben Monate nehmen
Ob eine stärkere Beteiligung der Väter in den ersten Lebensmonaten des Kindes in der Bevölkerung akzeptiert ist, hat das Institut Arbeit und Qualifikation im Auftrag der Bertelsmann Stiftung mittels einer Vignettenbefragung erforscht. Das Ergebnis: Sowohl Frauen als auch Männer ziehen die gleichmäßige Ausgestaltung der Elternzeit vor. 45 Prozent der Frauen und 42 Prozent der Männer wollen das egalitäre Modell. 41 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer votieren für das traditionelle Modell. Zudem kann sich ein knappes Viertel aller Befragten sogar vorstellen, dass der Vater die längere Zeit Elterngeld bezieht. „Die Mehrheit der Paare ist längst bereit für eine faire Verteilung von Elternzeiten. Es wird höchste Zeit, dass die Politik eine moderne Elterngeldregelung beschließt, die den Vorstellungen der Eltern entspricht und Väter stärker einbindet – ohne zu starke finanzielle Einbußen für Familien“, sagt Michaela Hermann, Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann Stiftung.
Das würde auch eine Schwäche der aktuellen Elterngeldregelung beheben: Denn wenn Väter nur zwei Monate Elternzeit nehmen, hat dies laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung keinen positiven Effekt auf die schnellere Rückkehr von Frauen in den Job. „Und das kostet: Individuell führt es zu Karrierebrüchen, geringerem Einkommen und später weniger Rente für Frauen. Aber es bedeutet auch: weniger Fachkräfte und ein Verlust an Wirtschaftswachstum“, betont Hermann. Nehmen Väter stattdessen vier bis sechs Monate Elternzeit, dann unterbrechen Frauen im Mittel nur noch acht statt 11,6 Monate ihre Erwerbstätigkeit.
Reform des Elterngeldes rechnet sich, bringt Fachkräfte und Wirtschaftswachstum
Eine Elterngeldreform würde aber nicht nur eine gerechtere Aufteilung der Sorgearbeit ermöglichen. Weil die Frauen früher an den Arbeitsmarkt zurückkehren, ließen sich so auch Fachkräfte gewinnen und die Wirtschaft stärken. Konkret schlagen die Expert:innen eine Ausweitung der bisher zwei auf mindestens vier Partnermonate sowie eine Erhöhung der Lohnersatzrate von bisher 65-67 auf 80 Prozent vor. Ein höheres Elterngeld stabilisiert das Haushaltseinkommen, Väter erhalten einen stärkeren Anreiz, Sorgearbeit zu übernehmen, und Mütter können schneller wieder ihre Erwerbsarbeit aufnehmen. Selbst bei vorsichtigen Schätzungen würde dadurch zusätzliche Beschäftigung in Höhe von 200.000 Vollzeitstellen entstehen.
Auch nach Abzug der Kosten für ein erhöhtes Elterngeld würde dadurch das BIP um 16,5 Milliarden Euro steigen – ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozentpunkten. „Eine Reform der Elterngeldregelung wäre eine lohnende Investition für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit“, betont Eric Thode, Volkswirt und Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann Stiftung. „Und die langfristig positiven Effekte für die Einkommen und Renten von Frauen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.“
Ostdeutsche Frauen besonders deutlich für faire Aufteilung
Wie prägend das kulturelle Umfeld langfristig ist, zeigt sich auch im regionalen Vergleich. Ostdeutsche Frauen, die auch nach Geburt ihrer Kinder früher in den Beruf zurückkehrten, bevorzugen mit 50 Prozent eine egalitäre Elternzeit-Aufteilung – deutlich mehr als westdeutsche Frauen (44 Prozent) und Männer (knapp 43 Prozent). Die geringste Zustimmung für eine gleichmäßige Aufteilung zeigen mit 40 Prozent ostdeutsche Männer.
Eltern wünschen sich weniger Behördenkram und leichtere Antragstellung
Die befragten Eltern wurden außerdem gebeten, anzugeben, welche Maßnahmen ihnen in der Kinderphase bei der Vereinbarkeit helfen würden. „Weniger Behördenkram und eine leichtere Antragstellung“ werden am häufigsten genannt (44 Prozent). Rund ein Drittel der Eltern sagt, eine kostenlose Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten und eine bezahlte Haushaltshilfe würde sie entscheidend entlasten. Weder für Frauen noch für Männer steht eine Reduzierung der Arbeitszeit ganz oben auf der Wunschliste. „Der Wille zur Erwerbsarbeit ist nach wie vor da. Die Übernahme von Sorgearbeit darf für Eltern deshalb nicht zu Lasten der beruflichen Entwicklung gehen“, sagt Michaela Hermann.

Jansen, A. und Kümmerling, A.
Spannungsfeld Vereinbarkeit: Elternzeitpräferenzen
und Vereinbarkeitswünsche von Frauen und Männern.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Gütersloh
Zusatzinformationen:
Die Studie ist der dritte Teil einer Veröffentlichungsreihe des Projekts „Spannungsfeld Vereinbarkeit: Onlinebefragung zur Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit im Paarkontext“, das das Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt hat. Die Datengrundlage bildet eine Onlinebefragung von 2.523 Frauen und Männern im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre). Die Befragung wurde zwischen dem 19.12.2023 und dem 19.1.2024 vom Umfragezentrum Bonn und einem Online-Access-Panel mit Incentivierung von bilendi durchgeführt. Sie wurde im Rahmen der ESOMAR-Richtlinie durchgeführt, das für die Erhebung genutzte Panel ist nach ISO 20252:2019 zertifiziert.
Wir beziehen uns außerdem auf eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die die Erwerbsunterbrechungen von Müttern in Abhängigkeit der Elternzeit ihrer Partner untersuchte: Frodermann et al (2023): Elternzeiten von verheirateten Paaren: Mütter kehren meist schneller auf den Arbeitsmarkt zurück, wenn ihre Partner Elternzeit nehmen. IAB-Kurzbericht 1/2023, Nürnberg.
Quelle: Pressemitteilung Bertelsmann Stiftung
Hier haben wir über den zweiten Teil der Studie berichtet:


