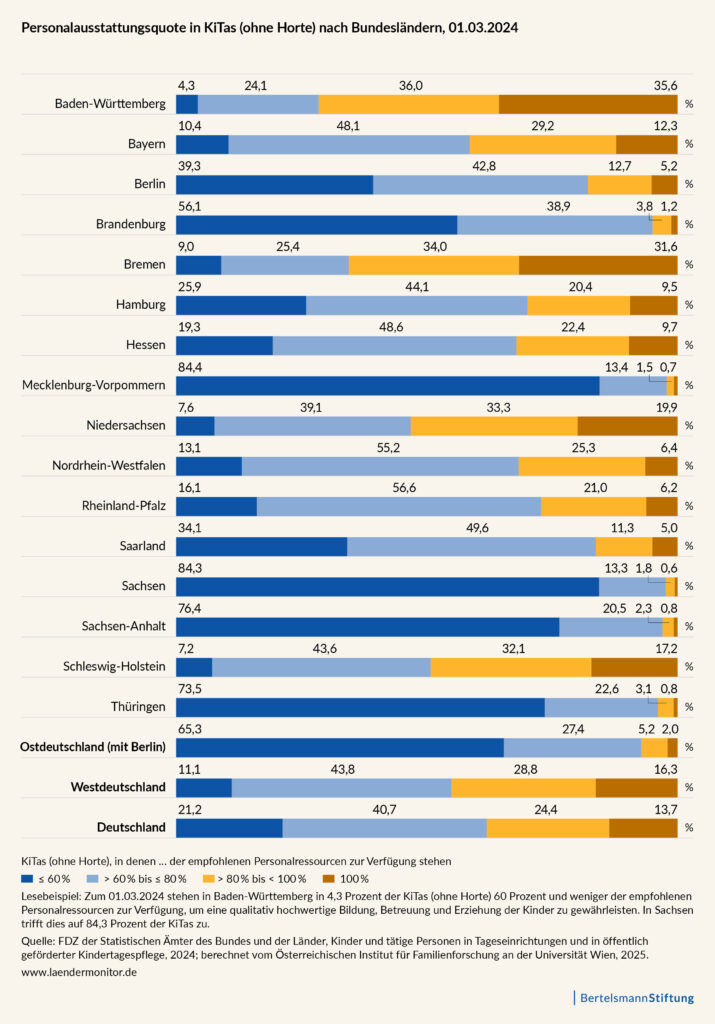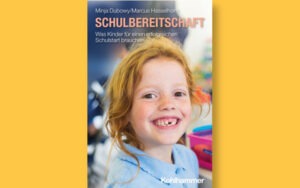Systematische Beobachtung in der Elementarpädagogik

Systematische Beobachtungen als Grundlagenqualität für eine ganzheitliche Elementarpädagogik
„Was tun Sie”, wurde Herr K. gefragt, „wenn Sie einen Menschen lieben?” „Ich mache mir einen Entwurf von ihm”,sagte Herr K., „und sorge, dass er ihm ähnlich wird.” „Wer, der Entwurf?”„Nein”, sagte Herr K., „der Mensch.”
(Bertolt Brecht)
Beobachtungen bilden für Fachkräfte eine Datenbasis, die verlässliche Grundtatsachen liefert und Erkenntnisse für das weitere Arbeitsvorgehen ermöglicht. Beobachtungen lassen beispielsweise Hintergründe für Ereignisse erkennen und bringen Sinnzusammenhänge auf den Punkt. Werden notwendige Beobachtungen außer Acht gelassen, bleiben Fachkräften viele Erkenntnisse verschlossen, was eine professionelle, qualitätsgeprägte Arbeit zunichte macht. Beobachtungen sind ein überaus hilfreiches Instrumentarium, um Einzelsituationen genauer als zufällige Wahrnehmungen zu erfassen und Zusammenhänge zu erkennen.
Beispiele für Zusammenhänge
Erfassung von
- eigenen Verhaltensweisen, die sich förderlich oder hinderlich auf die Entwicklung von Kindern auswirken;
- eigenen Verhaltensmerkmalen, die eine fördernde oder hemmende Wirkung auf die Entwicklung einer kollegialen Zusammenarbeit haben;
- eigenen, typischen Ausdrucksformen, die als eine Folge biografischer Einflüsse zu verstehen sind;
- methodisch-didaktischen Arbeitsschritten und ihrer Wirkweise auf die Entwicklung von Kindern;
- spezifischen Verhaltensweisen der Kinder in Abhängigkeit von auslösenden oder verursachenden Situationen und (un)mittelbaren Folgen auf das von Kindern gezeigte Verhalten;
- elterlichen Verhaltensweisen und kindeigenen Reaktionsverläufen;
- spezifischen Verhaltensweisen einzelner Kinder in Abhängigkeit von räumlichen Bedingungen (Enge, Weite, Größe eines Raumes), materiellen Gegebenheiten (attraktive/ unattraktive Raumgestaltung, Überangebot oder Mangel an Materialien), der Kindergruppe (zu viele Kinder im Raum, Häufung, keine Häufung von Kindern mit problematischen Verhaltensweisen), strukturellen Bedingungen (attraktive/unattraktive Angebote, freiwillige/zwangsbedingte Annahme von Angeboten, eng oder weit strukturierter Tagesablauf, Regelübermaß oder Regellosigkeit in der Gruppe …);
- spezifischen Verhaltensweisen der Kinder in Abhängigkeit von der aktuellen Qualität der kollegialen Zusammenarbeit (Teamatmosphäre);
- Verhaltensweisen einzelner Kinder, ausgelöst durch spezifische Verhaltensweisen anderer Personen (Hinweis: Rollen in Gruppen, Gruppensoziogramm);
- Kompensationsmöglichkeiten für Kinder, um ihnen alternative Erlebnisse und Verhaltensmöglichkeiten anzubieten;
- Wirkweisen bestimmter Projekte auf besondere Verhaltensweisen einzelner Kinder;
- spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern im Hinblick auf zu planende Projekte und besondere Aktivitäten.
Beispiele für Einzelsituationen
Erfassung von
- eigenen Verhaltensmerkmalen, die sich förderlich oder hinderlich auf die eigene Weiterentwicklung (privat wie beruflich) auswirken;
- spezifischen Merkmalen, die sich in der Entwicklung von Kindern aufbauen, manifestieren, stabilisieren oder abbauen;
- eigenen Verhaltensmerkmalen, die in ihrer Wirkung entlastend oder belastend sind, die für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit sorgen oder die eine weitere Entwicklung ermöglichen oder unterbinden.
Diese wenigen Beispiele machen deutlich, dass Situationsergebnisse oder zu beobachtende Verhaltensweisen – von Kindern und Erwachsenen – in der Mehrzahl das Ergebnis von zusammenhängenden Ereignissen sind! Diese Erkenntnis ist vor allem deshalb von großer Bedeutung für die (Sozial)Pädagogik, weil kindeigene Ausdrucksweisen in keinem Fall als isolierte Personkonstanten (= individuelle und gleichzeitig feststehende Persönlichkeitsmerkmale) eingestuft und als solche betrachtet werden sollen. Jedes Beobachtungsergebnis ergibt sich aus einer Fülle von unterschiedlichen Einflussgrößen und ist damit das Resultat eines Bedingungsgefüges.
So hat die Aussage „Nicht das Kind ist gestört, sondern die Umgebung, in der das Kind sein besonderes Ausdrucksverhalten zeigt” durchaus ihren Sinn. Würde nur allein das irritierende Verhalten von Kindern isoliert beobachtet und ebenso isoliert gedeutet werden, wären einer aus dem Sinnzusammenhang herausgelösten Bewertung Tür und Tor geöffnet. So gibt es eine ganze Reihe von Bedingungsfaktoren, die das besondere Verhalten von Kindern in einer speziell von ihnen so erlebten Situation auslösen, verursachen, verstärken oder unterdrücken. Eine genauere Analyse problematischer Entwicklungen macht schnell deutlich, dass es immer wieder besondere Einflussfaktoren sind, die auf Kinder und ihre Ausdrucksweisen wirken.
Hier sind vor allem folgende Merkmale zu nennen, die (in)direkt mit der elementarpädagogischen Fachkraft zu tun haben.
Faktoren, die das Verhalten von Kindern beeinflussen
1. Faktoren in Bezug auf die elementarpädagogische Fachkraft
- die „Persönlichkeitsstruktur” von Erzieher*innen und die damit verbundenen Persönlichkeitsmerkmale;
- die berufliche Erfahrung oder Unerfahrenheit der Fachkräfte;
- die bewussten und unterbewussten Erwartungen an das einzelne Kind/ die Kinder/ die ganze Gruppe;
- die individuelle, persönlich und beziehungsorientiert geprägte Einstellung zum Kind, das beobachtet werden soll;
- die individuell bewertete Erfahrung, die die Fachkraft bisher mit dem Kind gemacht hat;
- die möglicherweise (un)professionellen Handlungsstrategien, mit denen bisher die pädagogische Arbeit gestaltet wurde;
- die grundsätzlichen und subjektiven Einstellungen der Fachkraft zum Beruf (ihre Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, die erlebte Berufsbelastung)
- das Werte- und Normensystem, das den eigenen Verhaltensweisen und Erwartungen zugrunde liegt
2. Faktoren in Bezug auf die Einrichtung
- die konzeptionelle Grundlage für die Ausrichtung/Gestaltung der pädagogischen Arbeit;
- die ideologische Gestaltung der Pädagogik, die sich in der Arbeitsphilosophie zeigt;
- der einrichtungsspezifische Ansatz und seine Gestaltungsweise;
- die methodisch-didaktische Arbeitsgestaltung;
- der besondere Tagesablauf, dem die Kinder unterworfen sind und in der Regel von den Fachkräften, ohne Beteiligung der Kinder, festgelegt wurden;
- die örtliche Lage der Einrichtung mit großen oder kleinen Innenräumen oder Außenflächen und ihre Gestaltung.
3. Weitere Faktoren
Drittens haben auch die Erwartungen der Eltern an das Kind, die Einrichtung und die Fachkräfte einen Einfluss auf die Beobachtung und Beobachtungsrichtung. Eine weitere Rolle spielen die Erwartungen des Trägers an das Bild, das die Institution nach außen vermitteln soll. Hier wiederum wird von den Fachkräften einiges erwartet – beispielsweise, ob und wie stark auf Elternwünsche eingegangen werden soll.
Diese Aussagen machen noch einmal deutlich, dass jede Form der Beobachtung ihren besonderen Stellenwert sowie ihre ganz spezifische Aufgaben-/ Zielstellung besitzt und daher immer …
- gut vorbereitet sein will,
- eine klare Zielsetzung haben muss, die am besten schriftlich formuliert wird,
- so zu machen ist, dass Nebensächlichkeiten zwar registriert werden, aber nicht vom Beobachtungsziel ablenken dürfen,
- eine differenzierte Beschreibung der Zielpunkte möglich macht und damit jede Form einer frühzeitigen Bewertung ausschließt,
- möglichst schriftlich festzuhalten ist, um Beobachtungsverfälschungen durch subjektive Gedanken auszuschließen,
- Sinnzusammenhänge erfassen muss, um mögliche Hintergründe erfassen zu können,
- nur dann sinnvoll ist, wenn aus den Auswertungen praktische Konsequenzen gezogen werden, die zu konkreten Handlungsvorhaben führen.
Eine Situation, ein Umstand oder eine Person kann nur dann umfassend und exakt beschrieben und beurteilt werden, wenn sorgsam zusammengetragene Fakten zur Verfügung stehen und das Material ausreichend ist, um eine fachlich begründete Aussage zu treffen. Wichtig sind qualitativ brauchbare und quantitativ umfassende Erhebungsgrundlagen.
Neben der Beobachtung gibt es weitere Datenbeschaffungstechniken, die je nach Fragestellung ihren ganz besonderen Wert haben. Folgende Grundsätze gelten für eine Datenerhebung:
Die Methoden der Datenerhebung sollen
- ein sachlich-beschreibendes Erfassen der benötigten Daten möglich machen,
- hilfreich sein für das weitere Vorgehen, um Zielsetzungen zu erreichen,
- Rückschlüsse ermöglichen, um Hintergründe zu verstehen,
- die ausschlaggebende Fragestellung möglichst exakt beantworten,
- die Fachkraft dazu veranlassen, ihre (schon im Voraus gefassten) Annahmen immer wieder neu zu überdenken, um Vorurteile verwerfen zu können und sich allein auf die gefundenen Ergebnisse zu verlassen.
Aufgaben:
- 1. Nehmen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Beobachtungspraxis vor und prüfen Sie, inwieweit Ihre Beobachtungen einer fachlichen Systematik entsprechen.
- 2. Prüfen Sie, bei welchen Aufgabenstellungen bisher systematische Beobachtungen eingesetzt wurden und bei welchen Aufgabenstellungen zielgerichtete Beobachtungen zu kurz gekommen sind.
- 3. Gehen Sie der Frage nach, welche Hintergründe es geben könnte, dass nicht in allen bedeutsamen Zusammenhängen entsprechende Beobachtungen eingesetzt wurden.
Diesen Artikel haben wir aus folgendem Buch entnommen:
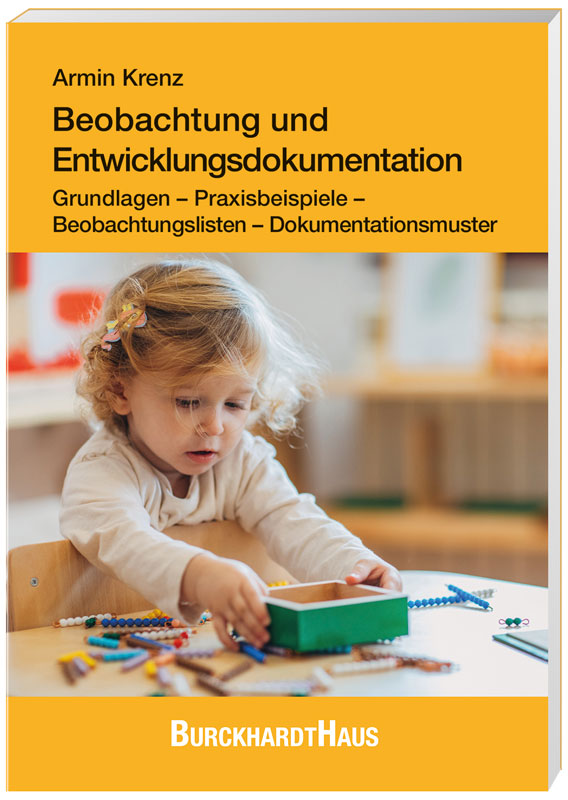
Beobachtung und Entwicklungsdokumentation
Grundlagen – Praxisbeispiele – Beobachtungslisten – Dokumentationsmuster
Burckhardthaus
ISBN: 978-3-96304-617-9
25,00 € (inkl. MwSt.)
Eigens für dieses Buch wurde die Website www.beobachten-und-dokumentieren.de eingerichtet, auf der sich die Formulare zum Download befinden. Das Buch richtet sich sowohl an Studierende der Sozial- und Heilpädagogik als auch an Erzieher*innen/Kindheitspädagog*innen, die schon im Beruf stehen.