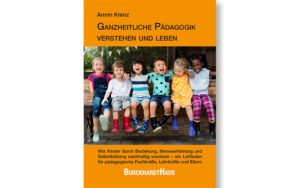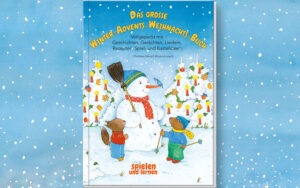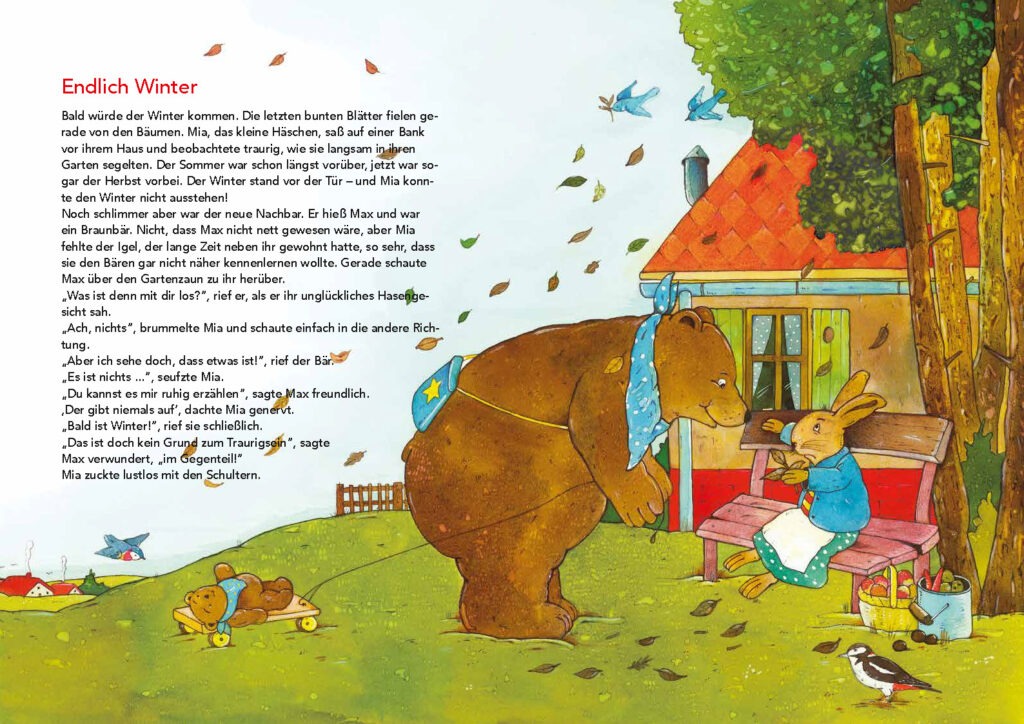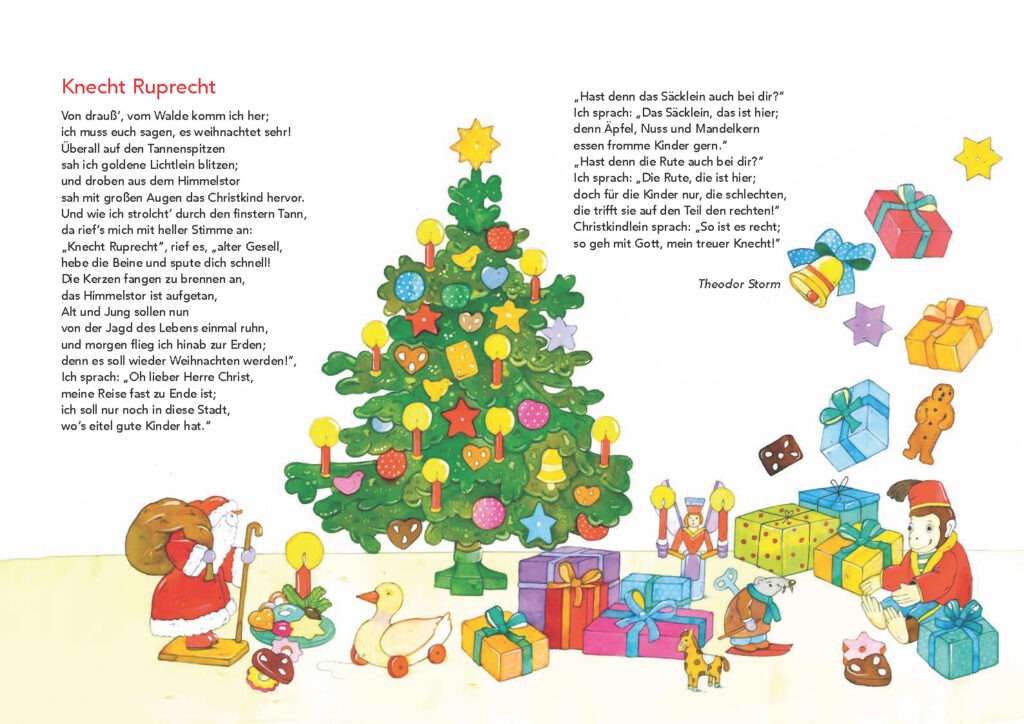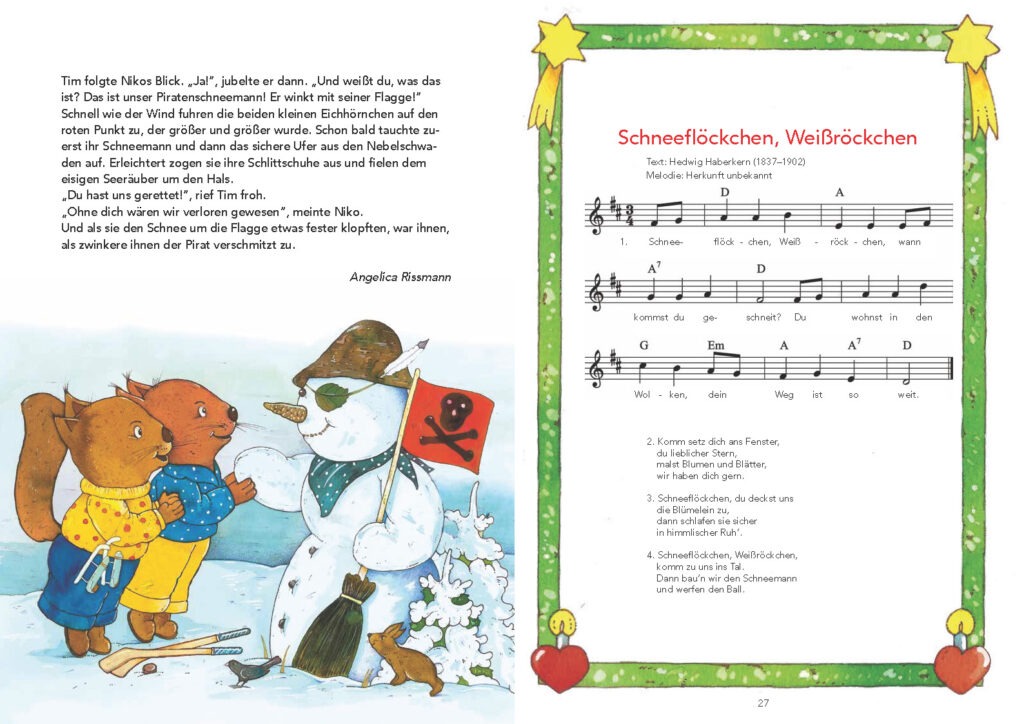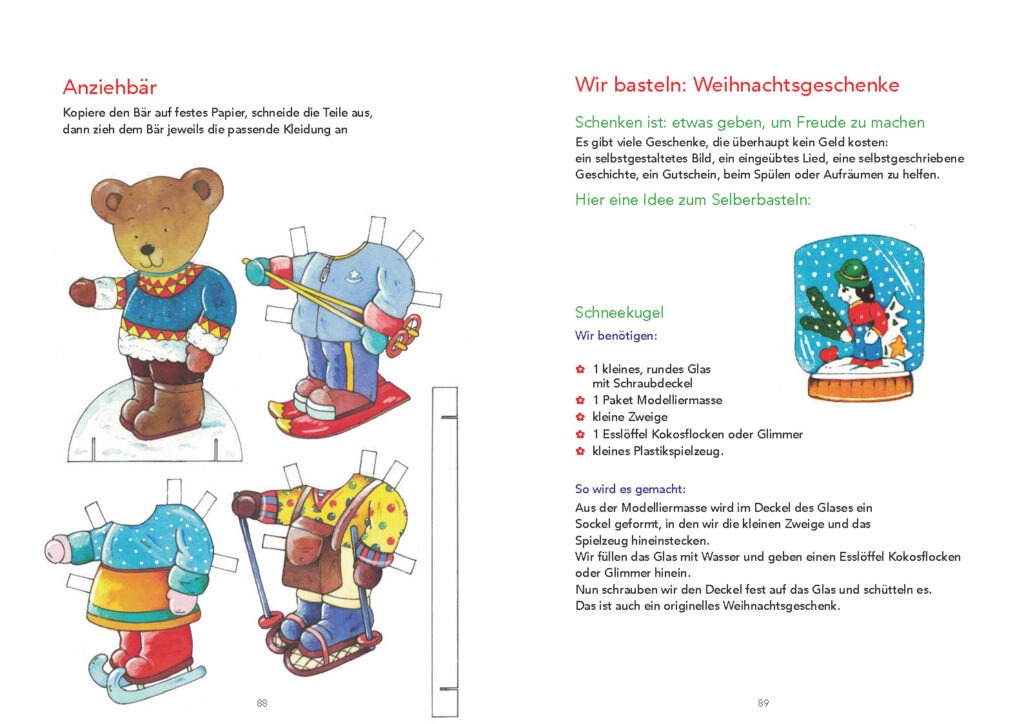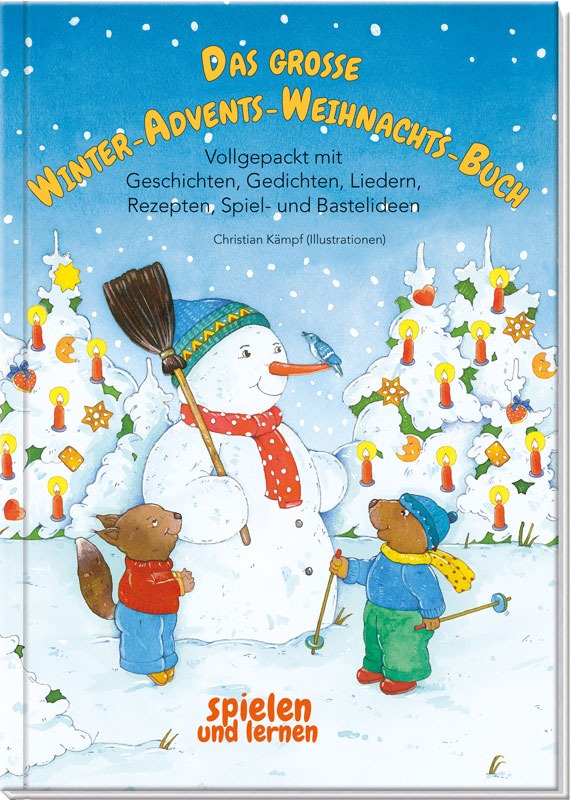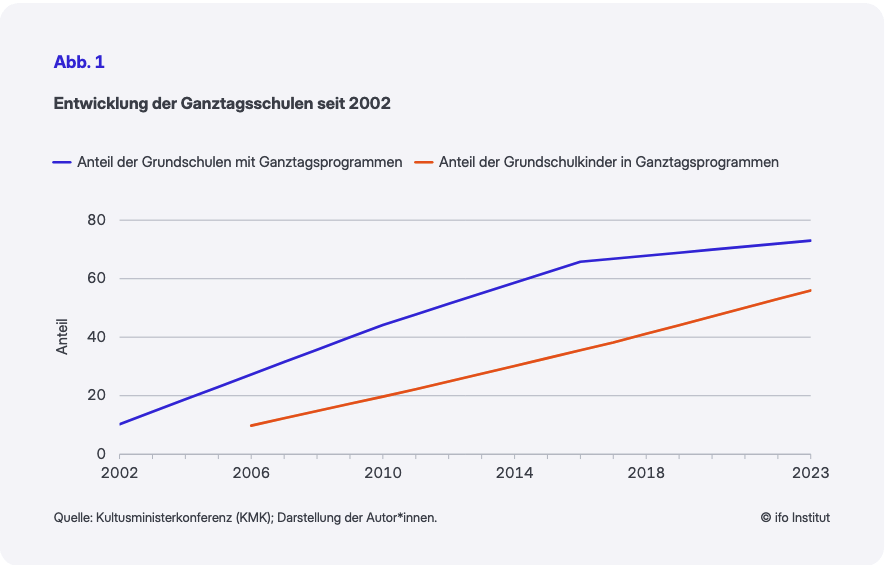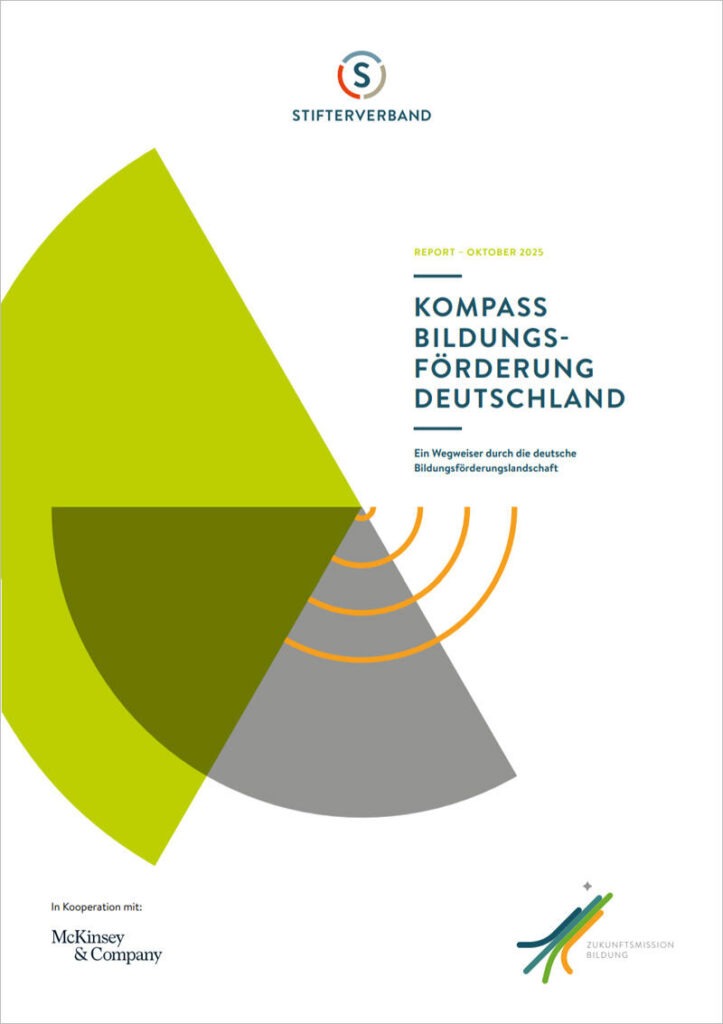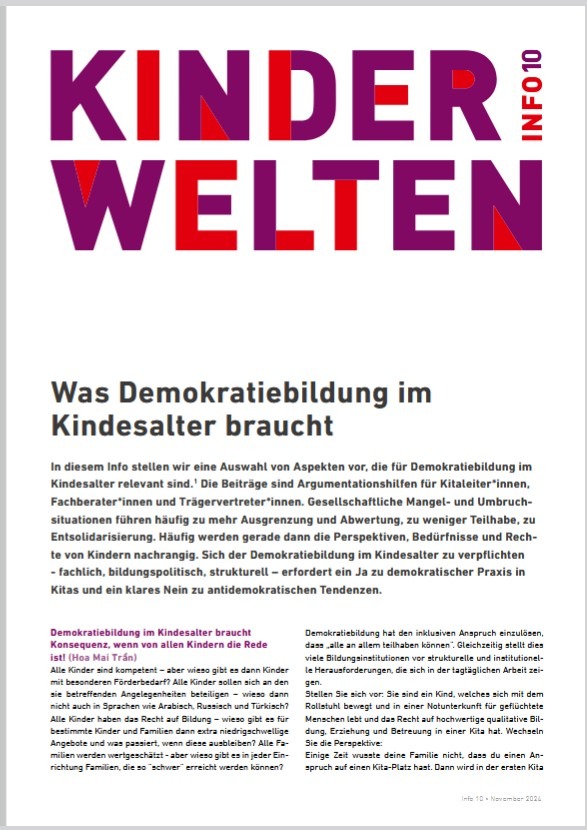Ringvorlesung zur Sprachbildung: Kinderrechte, Vielfalt und Inklusion

Kostenfreie Vortragsreihe für Interessierte aus Wissenschaft, Bildungspolitik und Fachpraxis, initiiert von der IU Internationalen Hochschule
Wie können Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung wirksam begleitet werden – und welche Rolle spielen Kinderrechte, Inklusion und gesellschaftliche Vielfalt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die digitale Ringvorlesung „Mitteilen – Miteinander teilen: Kindliche Sprachbildung und -förderung im Zeichen der Kinder- und Menschenrechtsbildung“, die am 20. Oktober 2025 startet. Alle Online-Vorträge sind kostenfrei und richten sich an Fachkräfte, Lehrkräfte, Eltern und alle Interessierten.
Die Reihe läuft bis März 2026, jeweils montags von 18 bis 20 Uhr im dreiwöchigen Rhythmus. Sie vermittelt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, bildungspolitische Entwicklungen und praxisnahe Ansätze für den pädagogischen Alltag.
Sprachbildung als Schlüssel für Teilhabe
Sprache ist ein Fundament für Bildung, Teilhabe und Demokratie. Doch Sprachbildung ist mehr als ein technisches Werkzeug: Sie bedeutet, Kinderrechte, Vielfalt und Teilhabe konsequent mitzudenken. Genau hier setzt die Ringvorlesung an – mit Impulsen aus Wissenschaft, Politik und Praxis.
„Sprachbildung erfordert eine professionelle Haltung, die Kinderrechte und Vielfalt in den Mittelpunkt stellt“, betonen die Leiterinnen Prof. Dr. Yvonne Decker-Ernst (IU Campus Freiburg) und Prof. Dr. Katharina Gerarts (IU Campus Mainz).
Themenvielfalt von Resilienz bis Mehrsprachigkeit
Die acht Vorträge greifen zentrale Fragen auf:
- Sprache und mentale Resilienz von Kindern
- Kulturbewusste Sprachbildung und Kinderschutz
- Kinderrechte und Demokratie im Kita-Alltag
- Umgang mit Mehrsprachigkeit
- Übergänge zwischen Kita und Schule
- Partizipation als Bedingung für Bildungserfolg
Begleitend erscheint ein Sammelband im Herder Verlag, außerdem ist im Sommer 2026 ein praxisorientierter Fachtag mit Podiumsdiskussion geplant.
Termine im Überblick
- 12.01.2026: Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Kita
- 02.02.2026: Diversitätssensible Sprachbildung in Kitas
- 23.02.2026: Sprachförderung am Übergang Kita–Grundschule
- 16.03.2026: Beteiligung als Bedingung für Bildungserfolg
👉 Mehr Informationen und Anmeldung: https://www.iu.de/duales-studium/b2b-newsletter/events-2025/ringvorlesung-wise-25-26/