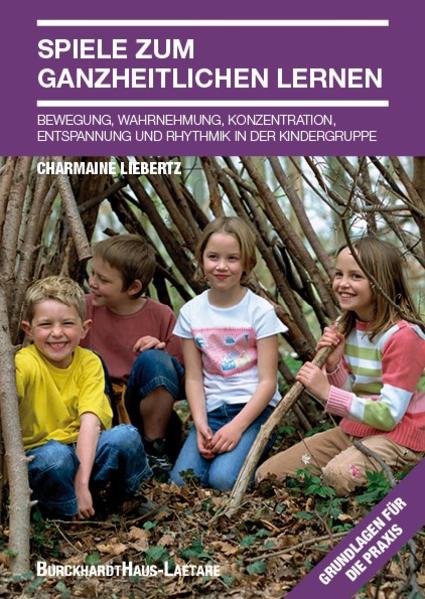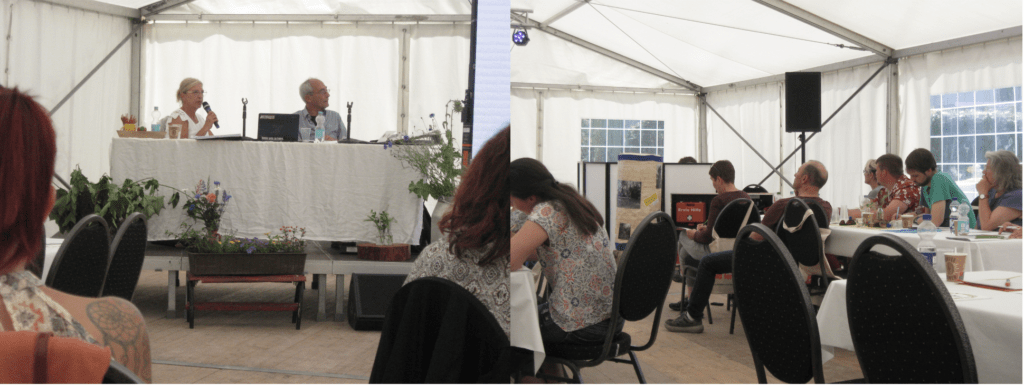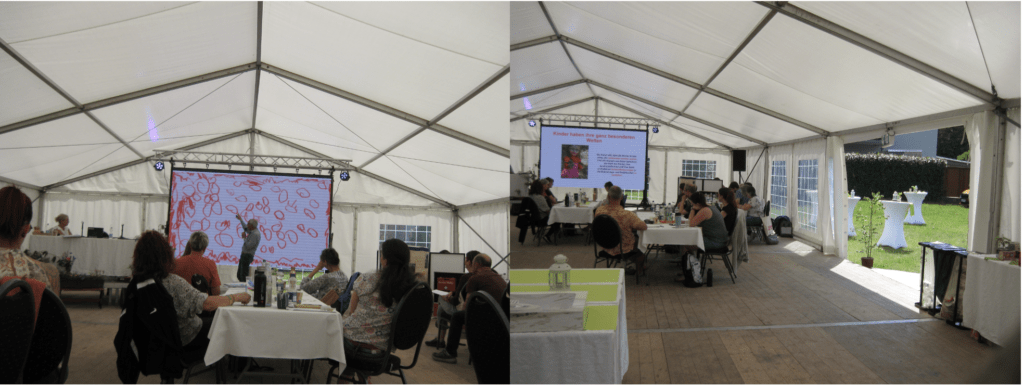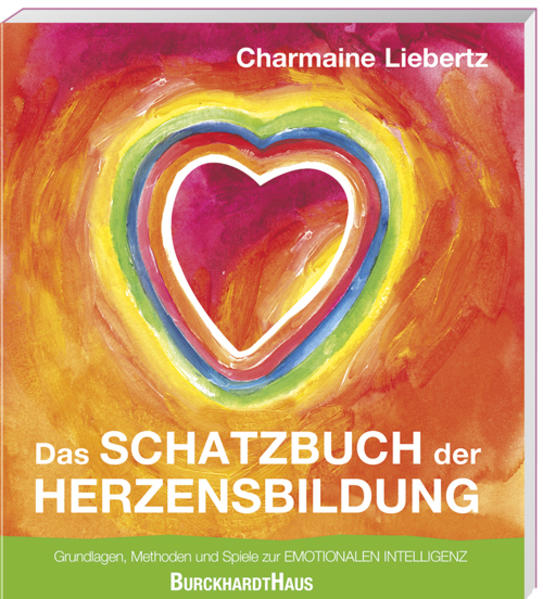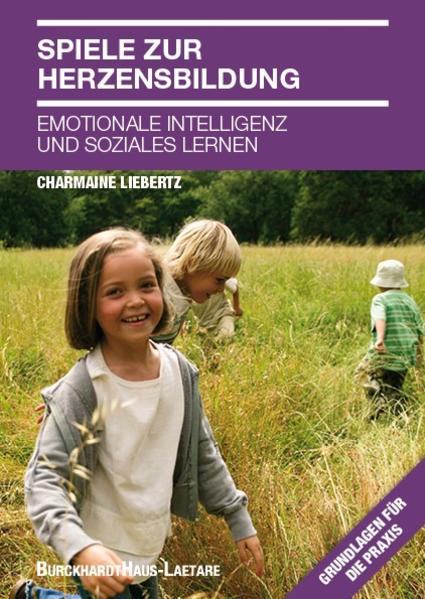Herzensbildung statt Leistungsdruck – Weil Kinder schöpferische Selbstbildung brauchen

Inklusion leben: Gemeinsam Potenziale entfalten, Vielfalt wertschätzen und miteinander wachsen
In unserer Gesellschaft dominiert zunehmend ein technokratisch-ökonomisches Menschenbild. Im Fokus steht, was für das spätere „Weiterkommen“ nützlich ist und als Kompetenzförderung gilt. Lebendige Beziehungszusammenhänge werden dabei auf messbare Fakten reduziert, analysiert und kategorisiert. Der subjektive Sinn des Handelns gerät in den Hintergrund, ebenso wie Gefühl und Wille des einzelnen Menschen.
Diese Haltung führt zu einer Kultur der Eile – und zu einem Mangel an feinfühliger Herzensbildung, die gerade in unserer Zeit dringend gebraucht wird. Besonders Kinder benötigen ein ganzheitliches Wissen und Können, ein Denken, Fühlen und Wollen, das ihnen hilft, sich zu orientieren, zufrieden und glücklich zu sein. Doch wie lässt sich diese schöpferische Selbstbildung ermöglichen?
Impulse von Gerald Hüther: Potenzialentfaltung als Lebensprinzip
Der renommierte Neurobiologe Gerald Hüther, Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung, betont: Menschen sollten von Beginn ihres Lebens bis ins hohe Alter die Gelegenheit haben, ihre Entwicklungsmöglichkeiten selbst zu entfalten.
Die Akademie geht von der Überzeugung aus, dass Potenzialentfaltung nur gelingen kann, wenn Menschen einander als Subjekte begegnen – statt sich gegenseitig zu Objekten von Bewertungen, Erwartungen oder Maßnahmen zu machen.
Im gesamten deutschsprachigen Raum entstehen heute in kleinen und großen Lebensgemeinschaften Orte, an denen ein friedliches Miteinander gepflegt wird. Die Forschungsergebnisse des Teams zeigen:
- Alle Menschen möchten ihr Leben so gestalten, dass sie glücklich sind.
- Leben ist ein Entwicklungsprozess – Stillstand verhindert Glück.
- Das in jedem Menschen angelegte Entwicklungspotenzial ist weitaus größer als bisher genutzte Fähigkeiten.
- Potenziale entfalten sich nur im Miteinander mit anderen Menschen.
- Gemeinschaften können ihre Strukturen jederzeit so verändern, dass Entwicklung nicht länger unterdrückt wird.
- Kreative und innovative Höchstleistungen entstehen nur in unterstützenden, inspirierenden Lebens- und Arbeitsgemeinschaften.
Gegen den Geist des „Survival of the Fittest“
Die Akademie für Potenzialentfaltung stellt sich bewusst gegen das heute verbreitete Konkurrenzdenken und orientiert sich an den Werten unserer Eltern und Großeltern: Menschlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Achtsamkeit, Weitsicht und vor allem Liebe im Umgang miteinander.
Nach Hüther bleibt die im Gehirn angelegte Freude am Entdecken und gemeinsamen Gestalten ein Leben lang erhalten. Menschen, die aus Freude schöpferisch tätig sind, suchen keine höheren Karrierestufen – sie wollen Sinn stiften.
Zurück zu den schöpferischen Wurzeln
Gefordert ist ein Umdenken: weg von reinem Leistungsdenken, hin zu einer Kultur des Erinnerns und des gemeinsamen Gestaltens. Kinder und Erwachsene sollten zusammen wachsen, spielen und lernen können – in einer Atmosphäre, die Mut macht und Hoffnung schenkt.
Ein Beispiel dafür ist das Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark: Hier gestalten Kinder und Erwachsene gemeinsam ein fröhliches Miteinander, das Zukunft verheißt und dem Negativen aus eigener Kraft entgegentritt.
Kinder als Lehrmeister der Herzensbildung
Sind nicht gerade Kinder, die aus ihren tief veranlagten rhythmisch-musikalischen Kräften heraus eine Welt des fröhlichen Miteinanders schaffen wollen, wahre Lehrmeister für ältere Menschen?
Wer das verneint, will oft durch die Macht des Wortes andere beherrschen. Doch wirkliche Stärke liegt darin, Menschen über alle Grenzen hinweg zu verbinden – mit Herzenskraft und sozialer Kompetenz.
Fazit mit Weitblick
Herzensbildung ist mehr als Wissen. Sie ist die Fähigkeit, sich im Herzen miteinander zu finden, jenseits aller äußeren Unterschiede. Wenn wir diese Kultur pflegen, verbinden wir Menschen über Generationen hinweg – und schaffen eine Welt voller Freude, Hoffnung und Zuversicht.
Prof. Dr. Ferdinand Klein
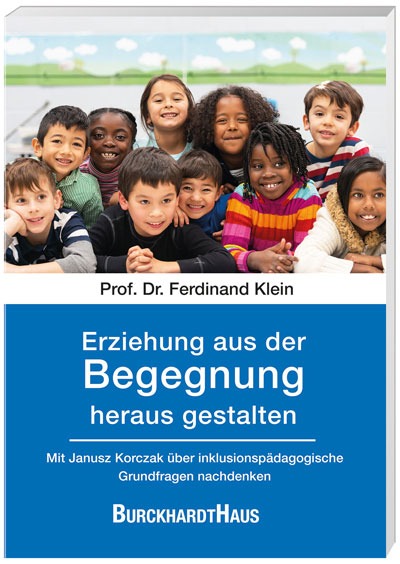
„Erziehung aus der Begegnung heraus gestalten“ von Prof. Dr. Ferdinand Klein macht das Vermächtnis von Janusz Korczak lebendig: Achtung vor der Würde jedes Kindes, gelebte Empathie und praxisnahe Tipps für den Alltag. Seine Darstellungen sind leicht verständlich und direkt in die pädagogische Praxis übertragbar. Ein inspirierendes Buch für alle, die Kindern auf Augenhöhe begegnen und ihre eigene pädagogische Haltung stärken wollen.
Prof. Ferdinand Klein
Erziehung aus der Begegnung heraus gestalten
Mit Janusz Korczak über inklusionspädagogische Grundfragen nachdenken
Softcover, DIN A5, 184 Seiten
ISBN: 978-3-96304-618-6
22 €