Studie warnt: früh am Smartphone – später in der Krise

Trotz eindeutiger Forschungsergebnisse setzen viele Kitas in Deutschland weiterhin auf Tablets – und ignorieren damit gravierende Risiken für die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen
Es ist immer einfacher, dem eigenen Kind das Smartphone in die Hand zu drücken, während man sich der Präsentation für den nächsten Arbeitstag widmet. Doch nach und nach wird aus dem gelegentlichen Ablenken ein immer häufiger geäußerter Wunsch – und schließlich ein nicht selten dramatisch inszenierter Anspruch. Auf Social Media kursieren inzwischen unzählige Clips, in denen Kleinkinder wütend oder gar hysterisch reagieren, wenn ihnen Smartphones oder Tablets verwehrt werden.
Dass es sich hierbei nicht nur um kurzfristige Erziehungskrisen handelt, zeigt nun eine aktuelle, internationale Langzeitstudie, die im Journal of Human Development and Capabilities veröffentlicht wurde. Die Forschenden rund um Dr. Tara Thiagarajan, Chefwissenschaftlerin der gemeinnützigen Organisation Sapien Labs, haben Daten von über 130.000 jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren aus weltweit mehr als 60 Ländern ausgewertet – darunter allein 14.000 in Indien.
Der frühe Smartphone-Zugang hinterlässt Spuren
Das zentrale Ergebnis der Untersuchung: Wer bereits vor dem 13. Lebensjahr ein Smartphone besaß, zeigte als junger Erwachsener deutlich häufiger Symptome schwerer psychischer Belastungen. Betroffen waren nicht nur depressive Verstimmungen und Angstzustände, sondern auch Realitätsverlust, Halluzinationen, Aggressionen und Suizidgedanken. Bei Frauen, die bereits mit fünf oder sechs Jahren ein Smartphone nutzten, lag der Anteil derjenigen mit suizidalen Gedanken bei alarmierenden 48 Prozent – bei gleichaltrigen Männern immerhin bei 31 Prozent.
Die Studie stellt zudem klar: Dieser Trend ist kulturübergreifend und unabhängig vom Herkunftsland konsistent – was die These untermauert, dass der Einfluss digitaler Geräte auf das sich entwickelnde Gehirn tiefgreifend und global vergleichbar ist. Die vollständige Studie ist öffentlich zugänglich über Sapien Labs (PDF) sowie auf EurekAlert.
Trotz Warnungen: Digitale Medien in deutschen Kitas auf dem Vormarsch
Vor diesem Hintergrund erscheint es geradezu paradox, dass es in Deutschland weiterhin Krippen und Kindertageseinrichtungen gibt, die gezielt Tabletzeiten für Krippen- und Kindergartenkinder einführen, statt Eltern über die langfristigen Risiken digitaler Mediennutzung im frühen Kindesalter aufzuklären.
Wissenschaftliche Warnungen gibt es längst nicht nur von Sapien Labs. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF weisen seit Jahren auf die negativen Folgen übermäßiger Bildschirmnutzung bei Kindern hin – insbesondere auf emotionale Belastungen, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und soziale Rückzugsverhalten.
Doch anstatt klare Präventionsmaßnahmen zu treffen oder medienfreie Räume zu schaffen, wird vielerorts weiterhin die sogenannte digitale Teilhabe auch im U3-Bereich als pädagogischer Fortschritt verkauft. Eine kritische Debatte über die tatsächlichen Kosten dieser Frühdigitalisierung findet bislang kaum statt.
Besonders bemerkenswert ist, dass Deutschland – gemeinsam mit Norwegen – offenbar eine der wenigen Ausnahmen bildet: Während in Schweden, Finnland, Estland und Dänemark der Einsatz von bildschirmgestützten Lernmitteln in Krippen nicht zum Standard gehört und teilweise durch Empfehlungen oder gesetzliche Einschränkungen ausdrücklich vermieden wird, experimentieren deutsche Träger sogar in U3-Gruppen mit Touchscreens, Tablets und digitalen Bildungsangeboten. Damit steht Deutschland international nahezu allein da – und das, obwohl viele der genannten Länder als Vorreiter einer wissenschaftlich fundierten Frühpädagogik gelten.
Was jetzt gebraucht wird
Dr. Thiagarajan fordert angesichts der Studienergebnisse nichts weniger als einen strikten Ausschluss von Smartphones für Kinder unter 13 Jahren – sowie umfassende politische und bildungssystemische Reformen, um Kinder und Jugendliche in digitalen Umgebungen besser zu schützen. Sie betont: „Wir sehen in den Daten eine sehr klare Altersgrenze, unterhalb derer der Zugang zu Smartphones massiv mit psychischer Instabilität im späteren Leben korreliert.“
Die Frage, die sich nun stellt: Wie viele wissenschaftlich fundierte Warnsignale braucht es noch, bis auch im deutschen Bildungswesen gehandelt wird? Und wie lange wird die Verantwortung für psychische Belastungen bei Heranwachsenden noch allein den Eltern zugeschoben – während Bildungseinrichtungen selbst aktiv zur digitalen Frühprägung beitragen?
Weiterführende Quellen:
- Studie im Journal of Human Development and Capabilities (DOI)
- PDF der Sapien Labs-Studie (Global Mind Project)
- Pressemitteilung bei EurekAlert
- Sapien Labs Website zur Studie
Gernot Körner
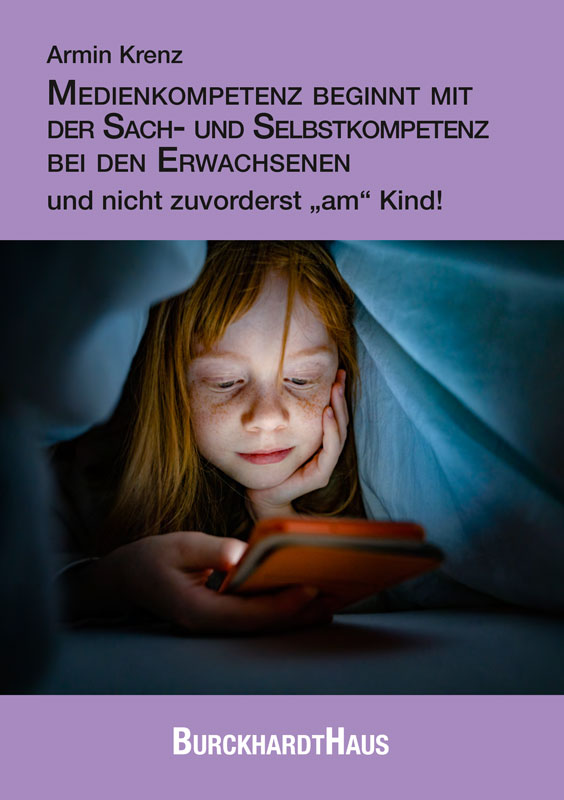
Medienkompetenz beginnt bei den Erwachsenen
Kinder jeden Alters erleben die vielfältige digitale Mediennutzung überall in ihrem Lebensalltag. Da bleibt es nicht aus, dass sie sich ebenfalls der Faszination digitaler Medien nicht entziehen können. Gleichzeitig gehört es zu den >Lebenskompetenzen< eines Menschen, mit den unübersehbaren und besonders verlockenden Angeboten in einer stark konsumorientierten […]weiterlesen






