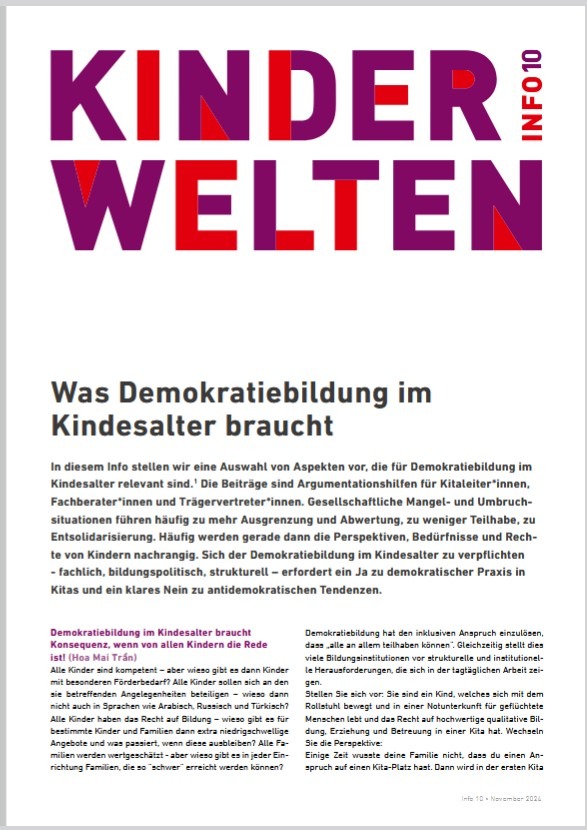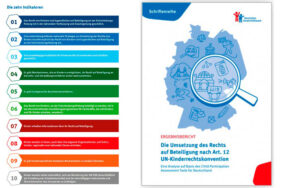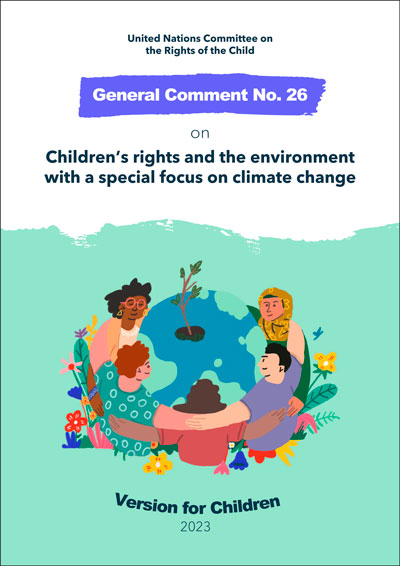Motto des Weltkindertags am 20. September 2024: „Mit Kinderrechten in die Zukunft“
Der Weltkindertag am 20. September steht im Jahr 2024 unter dem Motto „Mit Kinderrechten in die Zukunft“. UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk fordern zum 70. Geburtstag dieses Tages, dass die Politik ihre Prioritäten verstärkt auf Kinder ausrichten muss. „Denn jeder junge Mensch ist eine große Chance für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und es ist das Recht jedes Kindes, sich gut zu entwickeln und sein Leben gestalten zu können – ganz gleich, woher es kommt oder welchen Aufenthaltsstatus es hat“, heißt es in einer Erklärung von UNICEF Deutschland.
In Kinder zu investieren, sei gerade jetzt notwendig, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Gleichzeitig gälte es, die Kinder- und Menschenrechte als demokratische Gesellschaft gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung zu verteidigen.
Zuversicht und Ideen
„Wir brauchen Vielfalt und die Zuversicht und Ideen der jungen Generation, um unsere großen Zukunftsaufgaben als demokratische Gesellschaft zu meistern. Deshalb ist es gerade in einer Zeit großer Krisen und Herausforderungen so wichtig, sich entschlossen für jedes Kind und seine Rechte einzusetzen”, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. „Mit dem Motto des Weltkindertags im Jahr 2024 möchten wir das besonders unterstreichen.“
„Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit vielfältigen Fähigkeiten. Staat und Zivilgesellschaft müssen mehr dafür tun, dass sie stark und gleichberechtigt mit ihrer Kreativität und Kompetenz unsere Gesellschaft mitgestalten können“, sagt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Die Grundlage dafür ist die UN-Kinderrechtskonvention. Die muss in Deutschland endlich vollständig umgesetzt werden.“
70 Jahre Weltkindertag
Rund um den Weltkindertag am 20. September 2024 werden bundesweit zahlreiche Initiativen mit lokalen Demonstrationen, Festen und anderen Veranstaltungen auf die Situation der Kinder, ihre Rechte und ihre Zukunft aufmerksam machen. 70 Jahre, nachdem der Weltkindertag eingeführt wurde, weisen UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk mit dem Motto 2024 darauf hin, dass die Interessen und Rechte der Kinder auch heute richtungweisend für politische Entscheidungen der Gegenwart und Zukunft sein müssen.
Diskriminierung und Hass in jeglicher Form dürfen keinen Platz in der Gesellschaft haben. Die Zusagen im 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag für die Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen müssen bis zum Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden – dazu gehören beispielsweise die Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für jedes Kind, unabhängig von Herkunft oder Einkommen der Eltern und die Absicherung kindgerechter Lebensbedingungen für geflüchtete Kinder. Zudem fordern UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk von Bund und Ländern nachdrücklich die ebenfalls im Koalitionsvertrag angekündigte Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz.
Im September 1954 empfahlen die Vereinten Nationen ihren Mitgliedstaaten die Einführung eines weltweiten Tages für Kinder. Sie wollten damit den Einsatz für Kinderrechte stärken, die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen auf der Welt fördern und die Regierungen auffordern, die weltweite UNICEF-Arbeit zu unterstützen. Inzwischen wird der Weltkindertag in über 145 Staaten am 20. September gefeiert; seit 1989 sind die Kinderrechte mit einer UN-Konvention für jedes Kind verbrieft.
Quelle: Niklas Klütsch/UNICEF Deutschland