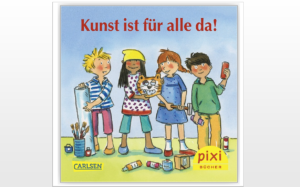Ein ganzer Monat „Kinderrechte-Spezial“ auf kindersache.de

Zum Weltkindertag am 20. September 2023
Das Deutsche Kinderhilfswerk feiert den Weltkindertag am 20. September digital mit einem großen „Kinderrechte-Spezial“ für Kinder in ganz Deutschland. Ab sofort dreht sich auf www.kindersache.de/weltkindertag im gesamten Monat September alles um die Themen Zukunft und Mitbestimmung. Dabei können die Kinder auf kindersache.de mehr über ihre Rechte erfahren, thematische Unterhaltungsangebote wahrnehmen oder selbst aktiv und kreativ werden. Der Fokus liegt dabei auf partizipativen Angeboten, die sich an der Lebenswelt von Kindern orientieren, um Kinderrechte nicht nur abstrakt zu erklären, sondern erlebbar zu machen.
Schwerpunktthema im September: Thema Zukunft
Inhaltlicher Schwerpunkt dieses „Monats der Kinderrechte“ ist das Thema Zukunft, und dabei insbesondere das Erreichen der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele („Sustainable Development Goals – SDGs“). Denn diese sind in Gefahr – und damit auch die Verwirklichung der Kinderrechte. Denn jedes der in der Agenda 2030 verankerten Ziele hat eine zentrale Bedeutung für Kinder und ihr Wohl. Bereits vor der COVID-19-Pandemie zeichnete sich ab, dass die bisherigen Fortschritte nicht ausreichen, um die Agenda 2030 zu verwirklichen. Die Folgen von Konflikten – insbesondere die gravierenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges –, von Klimawandel, Pandemie sowie der Wirtschafts- und Energiekrise gefährden das Erreichen der SDGs nun zusätzlich. Und sie bedrohen die Entwicklungschancen zahlreicher Kinder und Jugendlicher weltweit und in Deutschland.
Kinder in Deutschland erleben die Auswirkungen des Klimawandels
So erleben auch die Kinder in Deutschland die Auswirkungen des Klimawandels direkt in ihrem Lebensumfeld. Sie sehen, wie ihre Kinderrechte auf ein gesundes Aufwachsen und eine lebenswerte Zukunft missachtet werden, obwohl ihnen nach der UN-Kinderrechtskonvention ein besonderer Schutz zusteht. Das schürt Ängste und wirft viele Fragen bei Kindern auf: Sie wollen wissen, inwiefern der Klimawandel sie selbst und ihre Zukunft betrifft, wie sich Schule und Bildung verändern müssen, wie sie Geflüchteten helfen und wie sie sich für ihre Zukunft engagieren können.
Kinder können Neues über ihre Rechte lernen
In vielen interessanten Artikeln und spannenden Interviews mit Bildungsexpertinnen und -experten sowie Klimaaktivistinnen und -aktivisten können Kinder Neues über ihre Rechte lernen oder ihr Wissen vertiefen. In der Videoreihe „Kinder fragen – Expert*innen antworten“ erfahren sie, warum eigene Rechte für Kinder so wichtig sind und wie sie sich beschweren können. Dazu gibt es tolle Mitmach-Angebote wie eine Umfrage zur Schule der Zukunft, eine Postkartenaktion, mit der Kinder auf ihre Kinderrechte aufmerksam machen können sowie vielfältige und nachhaltige Basteltipps. Zudem können Kinder tolle Teilhabe-Projekte von anderen Kindern und Jugendlichen kennenlernen oder der kindersache-Community erzählen, was sie tun würden, wenn sie Chefin oder Chef von Deutschland wären.
Kinderrechtsorganisation nimmt Vernachlässigung der Belange junger Menschen wahr
„Als Kinderrechtsorganisation müssen wir insbesondere in der politischen Debatte in Deutschland eine geradezu sträfliche Vernachlässigung der Belange junger Menschen wahrnehmen. Kinderinteressen werden systematisch ausgeblendet, obwohl sie als ein vorrangiger Gesichtspunkt ins Zentrum politischen Handelns gehören. Die Interessen von Kindern und Jugendlichen müssen deswegen endlich konsequent aufgegriffen werden. Dazu möchten wir mit unserem ‚Kinderrechte-Spezial‘ auf kindersache.de beitragen. Alle Kinder und Jugendlichen können so beim Weltkindertag mitfeiern, egal, wo sie gerade sind, und das den ganzen September hindurch“, betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.
DKHW und UNICEF Deutschland fordern stärkeres politisches Engagement für eine lebenswerte Zukunft
Mit dem Motto des diesjährigen Weltkindertags „Jedes Kind braucht eine Zukunft!“ fordern das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland ein stärkeres politisches Engagement für eine gerechte und lebenswerte Zukunft junger Menschen und ermutigen die Bundesregierung, sich weiter für die Umsetzung der SDGs stark zu machen. Zur Halbzeit bei der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung appellieren die beiden Organisationen, das globale Versprechen einzuhalten, kein Kind zurückzulassen.
Aus Sicht der Organisationen muss die Politik Kinder sowie ihre Rechte dabei mehr als bisher in den Mittelpunkt stellen und vor allem Mädchen und Jungen stärken, die strukturell benachteiligt sind, wie Kinder in ärmeren Haushalten, geflüchtete und migrierte Kinder oder auch Kinder mit Behinderung. Einen wichtigen Beitrag dazu können unter anderem die Einführung der geplanten Kindergrundsicherung, der Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ und die Umsetzung der feministischen Entwicklungs- und Außenpolitik leisten. Um langfristig stabile und zukunftsfähige Gesellschaften zu entwickeln, sollten zudem alle Kinder von klein auf beteiligt und darin bestärkt werden, ihre Meinung zu Gehör zu bringen.
Quelle: Pressemitteilung: Deutsches Kinderhilfswerk e.V.