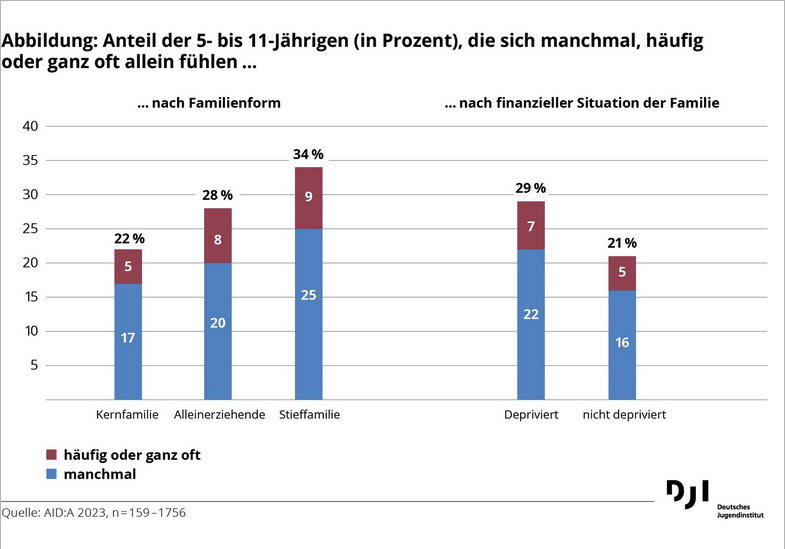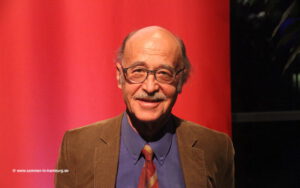Vortrag auf der didacta: Kinder haben ein Recht auf ihre Kindheit
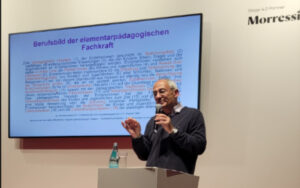
Prof. Dr. Armin Krenz plädiert auf der didacta 2026 für eine Elementarpädagogik, die sich konsequent an den Bedürfnissen von Kindern orientiert
In knapp zwei Monaten öffnet die didacta Bildungsmesse in Köln vom 10. bis 14. März 2026 wieder ihre Tore — und spielen und lernen ist mit dabei. Im Rahmen der Messe hält der bekannte Sozialpädagoge und Begründer des „Situationsorientierten Ansatzes“, Prof. Dr. Armin Krenz, einen Vortrag mit dem Titel:
„Kinder haben ein RECHT auf ihre Kindheit — Ein Plädoyer für eine kind(heits)orientierte Elementarpädagogik“
Der Vortrag findet am Dienstag den 10. März 2026 auf der Stiftungsfläche des Ausschusses Frühe Bildung im Didacta Verband in Halle 8, Stand D 044, von 14 bis 15 Uhr statt.
Zum Inhalt des Vortrags
Kinder brauchen Entwicklungsbedingungen, die ihnen helfen, eine sichere Identität aufzubauen, Lebensfreude zu verspüren, Lernfreude zu entdecken, Selbstbildung zu entwickeln und psycho-soziale Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten auszubilden, die ein hohes Maß an Nachhaltigkeit ermöglichen.
Diese lebensbedeutsamen Merkmale, die sich aus dem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag ableiten lassen, geraten jedoch zunehmend in Gefahr — dann nämlich, wenn das Kinderleben immer stärker durch Erwachsenenvorgaben fremdgesteuert wird, Kinderzeiten durch getaktete Zeitvorgaben zerrissen werden, Entwicklungsräume enger werden und Bindungssicherheiten immer weniger erlebt werden können.
Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick auf eine zentrale Frage:
Was brauchen Kinder wirklich — und was muss Elementarpädagogik leisten, um ihren Auftrag qualitätsorientiert und professionell erfüllen zu können?
Persönliche Begegnung mit Prof. Dr. Krenz
Prof. Dr. Armin Krenz wird von Dienstag 10.3. bis Donnerstag 12.3. auf der Messe anwesend sein. Am Stand der Körner Medien, zu der auch spielen und lernen gehört, wird es Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit ihm geben. Die genaue Standplatzierung steht derzeit noch nicht fest und wird nachgereicht.

Spiel ist Bildung — warum wir umdenken müssen
Das Spiel verliert in vielen Kitas zunehmend an Bedeutung — verdrängt durch Förderprogramme, Zeitdruck und wachsende Anforderungen an Fachkräfte. Dabei ist Spiel der Motor kindlicher Selbstbildung. Unsere Veröffentlichung zeigt, warum Spiel unverzichtbar ist und wie eine lebendige Spielpädagogik Kinder stärkt, Entwicklung ermöglicht und Bildung wieder kindgerecht macht.
Armin Krenz
Spiel und Selbstbildung – Kitas brauchen eine pädagogische Revolution
Softcover, 176 Seiten
ISBN: 978-3-96304-616-2
22 €