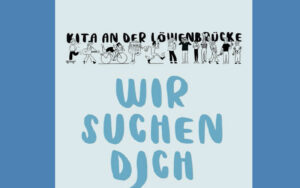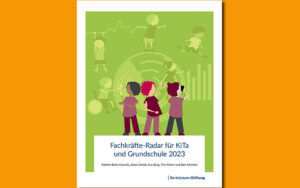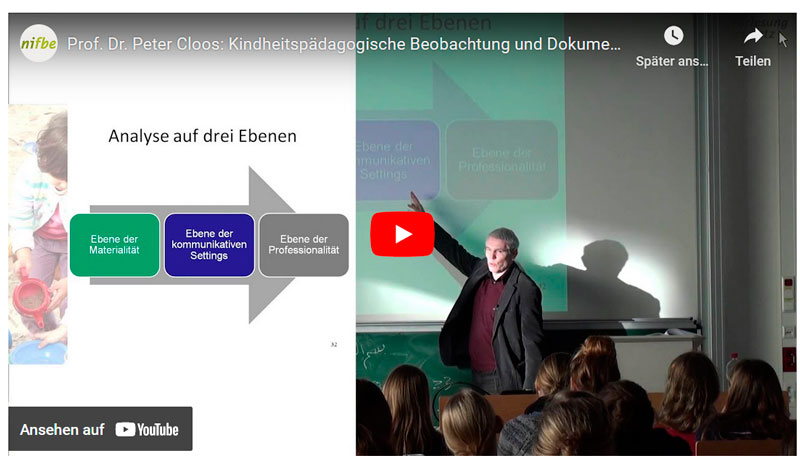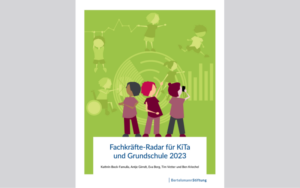Gute Software bietet große Chancen für Verwaltung und Dokumentation – nur wenige Anwendungen eignen sich für Kinder
Es könnte alles so schön sein! Seit einigen Jahren entlasten Kita-Software und-Apps pädagogische Fachkräfte in ihrer täglichen Arbeit merklich. So lassen sich KiTa und Personal deutlich einfacher verwalten als vormals mit Zetteln, Planern, Ordnern und schwarzem Brett. Auch digitale Portfolios und die Elternkommunikation erledigen sich so spürbar leichter. Und dank des technischen Fortschritts unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) vergeht kaum eine Woche, ohne, dass die eine oder andere Software mit neuen Innovationen aufwarten kann. Auch wenn sich die Umstellung auf die Verwaltung mit PC, Tablet und Smartphone oftmals als anstrengend und manchmal auch chaotisch erwiesen hat, sind am Ende wohl die meisten Nutzerinnen und Nutzer erleichtert und kaum jemand wünscht sich mehr in alte Zeiten zurück.
Schattenseiten, aber lösbare Herausforderungen
Wie jede Entwicklung hat auch diese ihre Schattenseiten. Nicht wenige pädagogische Fachkräfte klagen über unzureichende, ständig hakende Computersysteme, zusätzlichen Verwaltungsaufwand und schwindende Freiräume durch verbesserte Kontrollmechanismen seitens der Träger. Letzteres trifft allzu oft auch auf die Kinder zu, deren Eltern über die Apps über alles informiert sein sollen, was ihr Nachwuchs tut. Zudem tauchen immer wieder Verstöße gegen den Datenschutz auf. Der Mangel an Fachkräften und sonstigen Ressourcen verschärft die Herausforderungen vielerorts.
Dabei sind die Probleme durchaus lösbar. Oftmals mangelt es an Kompetenz, Austausch und Kooperationsbereitschaft. Statt sich praktischen bei Kollegen- und Expertenrat einzuholen, die Testversionen der verschiedenen Anbieter sorgfältig zu prüfen und gemeinsam im Team mit Unterstützung von Fachleuten bedürfnisorientiert zu planen, fallen zu viele einsame Entscheidungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich mit aufgezwungenen Systemen arrangieren. Dabei verführt das enorm große und stetig wachsende Feld an Möglichkeiten gelegentlich zu übersteigerten Erwartungen und Anforderungen, die allzu leicht zur Überforderung führen.
Die Fehler liegen oftmals in der Planung statt in der Technik
Letztlich sollten jedoch Führungs- und Planungsfehler nicht zur Verteufelung eines wirklich nützlichen Fortschritts führen, der ein Schlüssel zu wichtigen Erleichterungen sein kann. Lauter einer Umfrage von Wolters Kluwer unter rund 700 Leiterinnen und Leitern von KiTas, sehen viele noch einen deutlichen Verbesserungsbedarf in der digitalen Ausstattung ihrer Einrichtung, aber auch noch enormes Potenzial in der Nutzung digitaler Angebote. Wir stecken hier an vielen Stellen noch in den Kinderschuhen einer Entwicklung, von der niemand weiß, wohin sie führt.
Kein Ersatz für sinnliche Erfahrungen
In diesem Sinne macht die Digitalisierung nicht vor der Kindergartentür halt. Es ist jedoch unsere Entscheidung, wie weit wir diese gehen lassen. Weder der Körper noch das Gehirn des Menschen passen sich an die Digitalisierung an. Im Grunde sind wir noch immer genauso gebaut wie unsere Urahnen vor 200.000 Jahren. Als eines der bei der Geburt hilflosesten Wesen benötigt der Mensch viele Jahre um zu seiner Entwicklung. Das gilt für das Gehirn genauso wie für die Augäpfel. Und die Nutzung von Bildschirmen ist für beide eine Gefahr.
Die Hoffnung, mithilfe von Apps, Smartphones, Tablets und PCs Kinder schneller und effizienter zu bilden, hat sich längst zerschlagen. Zwar wischen die Kinder mit Begeisterung auf den Tablets herum, hören und schauen sich gerne mal eine Geschichte an, betrachten Bilder und Videos und spielen kleine Spielchen. Einen echten Bezug zu angebotenen Lehrinhalten finden sie aber nicht. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Je jünger Kinder sind, desto mehr sind sie darauf angewiesen, die Welt mit allen Sinnen zu begreifen. Ganzheitliche Erfahrungen lassen sich mit Bildschirmen jedoch nicht vermitteln. Und es kommt noch schlimmer. Offensichtlich beeinträchtigen die Bildschirme sogar die Entwicklung der Kinder.
Beispiel Schweden
Eines der jüngsten bekannten Beispiele ist die Entscheidung der schwedischen Regierung. Diese hob die Verpflichtung auf, Vorschulen mit digitalen Geräten auszustatten. Letztlich hatte die Regierung des einstigen Vorreiters der digitalen Bildung die Sorge um den stetigen Leistungsabfall ihrer Schülerinnen und Schüler dazu bewogen, die Karolinksa Universität mit dem zugehörigen Institut um eine Stellungnahme zu bitten. In der Stellungnahme heißt es unter anderem:
„Es gibt eindeutige wissenschaftliche Belege dafür, dass digitale Werkzeuge das Lernen der Schüler eher beeinträchtigen als verbessern.“
„Wir sind der Meinung, dass der Schwerpunkt wieder auf den Wissenserwerb über gedruckte Schulbücher und das Fachwissen des Lehrers gelegt werden sollte, anstatt das Wissen in erster Linie aus frei zugänglichen digitalen Quellen zu erwerben, die nicht auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.“
„Wichtige schulpolitische Entscheidungen sollten nicht getroffen werden, ohne dass man vorher weiß, was die Forschung sagt.“
Risiko Bildschirm
Ähnliche Entwicklungen lassen sich derzeit in Dänemark, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Neuseeland und Italien beobachten. Weltweit existiert mittlerweile eine Fülle von Studien, die auf die negativen Auswirkungen der Nutzung von Bildschirmgeräten auf die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern hinweisen. Dagegen gibt es noch immer keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die deren Nutzen beim Lernen belegen. Statt aber der Wissenschaft zu folgen, fordern hierzulande wirtschaftsnahe Stiftungen und weite Teile der Bildungswirtschaft einen „Digitalpakt Kita“.
Nicht zuletzt das hat unlängst eine Gruppe von 41 Wissenschaftlern dazu bewogen, ein Moratorium der Digitalisierung in KiTas und Schulen zu fordern. Hier heißt es unter anderem: „Tatsächlich sind die Wirkungen und Nebenwirkungen digitaler Medien auf Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozesse wissenschaftlich oft ungeklärt. Vielmehr verdichten sich die wissenschaftlichen Hinweise auf enorme Nachteile und Schäden für die Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen durch digitale Medien. Im Sinne der Fürsorgepflicht öffentlicher Bildungseinrichtungen fordern wir daher ein Moratorium der Digitalisierung insbesondere der frühen Bildung bis zum Ende der Unterstufe (Kl. 6).“
Zuerst müssten die Folgen der digitalen Technologien abschätzbar sein, bevor weitere Versuche an schutzbefohlenen Kindern und Jugendlichen mit ungewissem Ausgang vorgenommen würden.
Was die Befürworter digitaler Lernwelten stört
Selbstverständlich hat diese Erklärung besonders bei den Befürwortern der Digitalisierung heftige Reaktionen hervorgerufen. So fordert etwa Prof. Dr. Thomas Irion für den Grundschulverband: „Digitale Technologien bieten enorme Chancen für das Aufwachsen und die Bildung von Kindern… Schulen und KITAs müssen diese Bildungspotenziale nutzen, um Kinder angemessen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.“ Und Jasmin Block schreibt im „Handbuch digitale Kita“, das die Carlo & Friends GmbH herausgibt: „Und jene, die sich bereits fundiert mit früher Medienbildung auseinandergesetzt haben, schütteln fassungslos den Kopf. Denn längst reichte die Diskussion über das OB früher Medienbildung hinaus, indem Gestaltungsfragen, also das WIE, in den Mittelpunkt rückten.“
Zunächst sei Frau Block erst einmal mit einem Zitat aus Bertolt Brechts Dreigroschenoper geantwortet: „Wer a sagt, der muss nicht b sagen. Er kann auch erkennen, dass a falsch war.“
So viel dazu. Spannender wird es, sieht man sich die Argumente der Befürworter an:
- Wir dürfen die Augen nicht vor dem soziokulturellen Wandel verschließen. „Die Digitalisierung ist! Und um es einmal deutlich zu sagen: Auch in der frühen Bildung müssen wir lernen, sinnvoll und verantwortungsvoll damit umzugehen.“
- „Die Lebenswelt der Kinder und Familien ist durchdrungen von digitalen Medien. Die frühe Bildung, Erziehung und Betreuung hat aus gutem Grund den Anspruch, lebensweltrelevante Themen in der pädagogischen Arbeit aufzugreifen.“
- Die bekannten Studien, die auf negative Auswirkungen der Bildschirmmedien auf Kinder hinweisen, würden keine kausalen Zusammenhänge belegen.
Zum soziokulturellen Wandel
Soziokultureller Wandel oder sozialer Wandel sind großartige Wörter. Die Digitalisierung ist ein Teil davon, genauso wie die sozialen Verwerfungen, die Umweltverschmutzung, das Artensterben, die Verkehrswende, der Klimawandel, die Bildungsmisere, die Kirchenaustritte und vieles andere. Warum ausgerechnet 41 Wissenschaftler, die sich zum Großteil mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf unser Leben auseinandersetzen, die Augen vor der Digitalisierung verschließen würden, scheint absurd. Aber wer fordert, dass Kindergartenkinder nun lernen müssen, sinnvoll und verantwortungsvoll mit der Digitalisierung umzugehen, nimmt zum einen auf unverantwortliche Weise einen sehr hohen Preis bezüglich der Entwicklung von Kindern in Kauf und ignoriert die tatsächliche intellektuelle Reife von Kindern unter sechs Jahren. Damit Kinder eines Tages wirklich Verantwortung übernehmen zu können, wäre eine Entwicklungsbegleitung nötig, die sich an den notwendigen physischen und psychischen Bedürfnissen der Kinder orientiert.
Die Lebenswelt ist durchdrungen von digitalen Medien
Richtig. Die digitalen Medien sind wesentlicher Bestandteil unseres Daseins, wie die anderen Medien, die Mobilität oder die Arbeitswelt. Nur kommt eben niemand auf die Idee Kleinkinder den Führerschein machen zu lassen oder eine Berufsausbildung. Auch das Lesen und Schreiben bringen wir Kindern erst in der Schule bei, weil es ihrer Entwicklung entspricht. Dass Kleinkinder bereits Mobiltelefone nutzen, scheint sich fatal auszuwirken. Den verantwortungsvollen Umgang damit können wir ihnen aber in diesem Alter nicht beibringen. Um den Umgang zu reduzieren, wäre eine klare Haltung seitens der Pädagoginnen, Pädagogen und Eltern sinnvoll. Wer ein Kind unter sechs Jahren nicht davon abhalten kann, Smartphones oder Tablets ungehemmt zu nutzen, hat sollte dringend seine pädagogischen Fähigkeiten hinterfragen. Die Vermittlung von Medienkompetenz muss sein, aber sie sollte zu dem Zeitpunkt und in einem Umfang stattfinden, der aus medizinischer Sicht der Gesundheit der Kinder nicht schadet.
Mangel an Kausalität?
Bislang stützt sich die Forschung über digitale Medien bei Kindern vor allem auf sogenannte Querschnittserhebungen. Man erfasst dabei üblicherweise mittels Fragebogen verschiedene Aspekte wie die Smartphone-Nutzung und das Wohlbefinden zum selben Zeitpunkt. Auch wenn es sich dabei um eine Fülle von Studien handelt und die Gruppen der Probandinnen und Probanden gelegentlich sehr groß sind, weisen diese keinen kausalen Zusammenhang nach. So bleibt etwa die Frage offen, nutze ich das Mobiltelefon weil es mir schlecht geht oder geht es mir schlecht, weil ich das Mobiltelefon nutze?
Kausalität bedeutet eine direkte Beziehung zwischen Ursache und Wirkung herstellen zu können. Mit den bildgebenden Verfahren im Bereich der Neurobiologie meinen etwa Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler die negativen Wirkungen von Bildschirmmedien auf das Gehirn nachweisen zu können. Das reicht den Kritikerinnen und Kritikern jedoch nicht aus. Ein kausaler Zusammenhang könnte dann hergestellt werden, wenn man etwa zwei repräsentativ zusammengesetzte Gruppen von Kindern im gleichen Umfeld bildet und die eine Gruppe Bildschirmmedien aussetzt und die andere nicht. Solche Studien sind aus ethischen Gründen seit der Nazizeit verboten.
Tatsächlich gibt es mittlerweile Studien, deren Leiterinnen und Leiter meinen, einen kausalen Zusammenhang nachweisen zu können. Doch selbst wenn dies umstritten bleibt: Es gibt keine Studie, die eine positiven Effekt auf das Lernen von Kindern nachweist. Und die Ignoranz, mit der viele Pädagoginnen und Pädagogen die ernsthaften Bedenken der Medizinerinnen und Mediziner einfach beiseite schieben, mutet doch schon eher als grobe Fahrlässigkeit an.
Lassen wir den Kindern genug Zeit?
Wäre es deshalb nicht doch sinnvoll, erst einmal verlässliche Wissenschaftliche Ergebnisse abzuwarten? Rechtfertigt sich mit Blick auf die wachsende Zahl wissenschaftlicher Arbeiten, die negative Auswirkungen von Bildschirmmedien auf Kinder nahelegen, deren Einsatz in Krippen, Kindergärten und Schulen? Oder wäre es nicht doch besser, zumindest bis zum Eintritt der Kinder in die weiterführende Schule oder zumindest bis zum Eintritt in die Grundschule zu warten? Schließlich bleibt hier doch noch genügend Zeit, Medienkompetenz und technisches Know-how zu vermitteln.
Bedingter Einsatz mit Augenmaß
Zwar darf es eigentlich keine zwei Meinungen geben, wenn es um die Gesundheit von Kindern geht. Dennoch gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, die den Einsatz von Bildschirmgeräten ab der Kindergartenzeit in einem begrenzten Zeitraum zulassen und sinnvoll erscheinen lassen. Selbst der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sieht kein Problem darin, wenn Kinder ab drei Jahren maximal 30 Minuten pro Tag vor dem Bildschirm sitzen.
Für Kinder unter drei Jahren gilt das jedoch nicht und bei Kindern über drei Jahren sollte es nicht mehr sein. Dennoch reicht die Zeit, um sich Fotos oder ein Video auf einem Bildschirm anzusehen oder sich ein digitales Bilderbuch anzusehen und eventuell in der eigenen Muttersprache anzuhören. Möglichkeiten gibt es zuhauf. Und dann wird es wieder Zeit für die vielen sinnlichen Erlebnisse, die Kinder für ihr Leben benötigen und die durch digitale Geräte – zumindest bisher – nicht ersetzt werden können.
Alle Kompetenzen auch für die digitale Zukunft fördern
In der digitalen KiTa der Zukunft werden also hoffentlich keine Kinder mit Tablets durch die Gegend laufen. Die pädagogischen Fachkräfte aber vermutlich schon: vornehmlich um zu verwalten, die Entwicklung der Kinder zu dokumentieren und mit ihnen gelegentlich darauf etwas zu entdecken. In der Hauptsache wird sich aber auch die digitale KiTa der Zukunft darauf konzentrieren, Kinder ganzheitlich in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen, damit diese ihre eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten in ihrem persönlichen Tempo aufbauen, um dann eines Tages auch sinnvoll und verantwortungsvoll mit sich und ihrer Umwelt umgehen zu können, wozu auch die digitale Welt gehört.
Gernot Körner