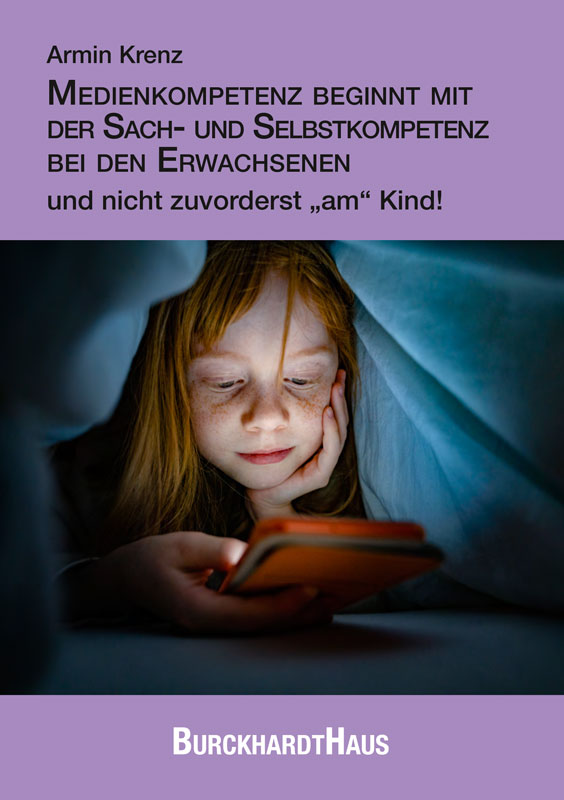Bildschirmzeit im Kleinkindalter erhöht später das Angst-Risiko

Eine große Längsschnittstudie zeigt, wie frühe Mediennutzung die Gehirnentwicklung beeinflusst – und welche Folgen das für Entscheidungsfähigkeit und psychische Gesundheit von Kindern haben kann
Wie viel Bildschirmzeit ist für kleine Kinder unproblematisch? Eine aktuelle neurowissenschaftliche Längsschnittstudie aus Singapur liefert dazu neue Hinweise: Eigentlich sollten kleine Kinder überhaupt nicht vor einem Bildschirm sitzen. Doch je mehr Zeit sie bereits im Kleinkindalter vor Bildschirmen verbringen, desto höher ist ihr Risiko, später Ängste zu entwickeln. Der Zusammenhang ist dabei nicht nur statistisch, sondern neurobiologisch erklärbar.
Die Forschenden untersuchten 168 Kinder aus der bekannten GUSTO-Geburtskohorte über mehr als zehn Jahre hinweg — von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. Dabei kombinierten sie Elternbefragungen zur Bildschirmzeit mit wiederholten MRT-Untersuchungen des Gehirns, kognitiven Tests und Fragebögen zur psychischen Gesundheit.
Analyse verschiedener Entwicklungsstufen
Die Studie analysierte folgende Entwicklungsstufen:
• Bildschirmzeit im Alter von 1–2 Jahren, erfasst durch Elternfragebögen
• Gehirnentwicklung im Alter von 4,5 bis 7,5 Jahren, gemessen mit moderner diffusionsbasierter Magnetresonanztomographie
• Entscheidungsverhalten mit 8,5 Jahren (Cambridge Gambling Task) und
• Angstsymptome mit 13 Jahren (MASC-Fragebogen)
Besonders betrachtet wurde dabei, wie sich die Vernetzung zwischen visuellen Hirnarealen und dem sogenannten kognitiven Kontrollnetzwerk entwickelt — also jener Hirnstruktur, die unter anderem Aufmerksamkeit, Selbststeuerung und bewusste Entscheidungen ermöglicht.
Zentrale Ergebnisse der Studie
Die wichtigsten Befunde lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Bildschirmzeit im Kleinkindalter beschleunigt die Reifung bestimmter Hirnnetzwerke.
Diese „beschleunigte Reifung“ klingt zunächst positiv, bedeutet aber in diesem Fall eine zu frühe funktionale Spezialisierung — zulasten der flexiblen Vernetzung im Gehirn.
• Diese veränderte Hirnentwicklung führt zu langsameren Entscheidungsprozessen im Schulalter.
Die betroffenen Kinder brauchten im Durchschnitt länger, um Entscheidungen zu treffen, obwohl sie nicht schlechter entschieden.
• Langsame Entscheidungsfindung war wiederum mit mehr Angstsymptomen im Jugendalter verbunden.
Erstmals konnte damit ein durchgängiger Entwicklungsweg gezeigt werden:
Frühe Bildschirmzeit → veränderte Gehirnreifung → verändertes Entscheidungsverhalten → mehr Angst im Jugendalter.

ADVERTORIAL
Blickkontakt und Bindung formen das Gehirn
Dr. Walter Hultzsch erklärt, wie Nähe, Blickkontakt und feine Signale die Entwicklung von Aufmerksamkeit, Selbstregulation und Persönlichkeit von Säuglingen fördern. Sein Buch verbindet neurowissenschaftliches Wissen mit alltagstauglicher Orientierung für Eltern, Großeltern, Paten und pädagogische Fachkräfte, die Babys in den ersten Lebensjahren achtsam begleiten wollen.
Dr. Walter Hultzsch
Hey Mama, schau mir in die Augen – und sprich mit mir – Bindung, Blickkontakt & frühe Kommunikation – wie sie das Gehirn deines Babys formen
120 Seiten, ISBN: 9783963040726, 20 €
Mehr zum Buch
Keine Bildschirmzeit im Kleinkindalter!
Letztlich sind diese Ergebnisse ein weiterer Beleg dafür, wie schädlich Bildschirmzeit im Baby- und Kleinkindalter ist. So haben wir erst vor knapp einem Monat über die Ergebnisse der Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD-Studie) berichtet, in der die Gesundheitsrisiken eines frühen Smartphone-Besitzes festgestellt wurden.
Die ersten Lebensjahre sind eine Phase extrem hoher Plastizität des Gehirns. In dieser Zeit wird nicht nur Wissen aufgebaut, sondern vor allem die Grundarchitektur des Denkens, Fühlens und Handelns geformt.
Die aktuelle Studie zeigt, dass intensive visuelle Reize durch Bildschirme:
• die sensorische Verarbeitung verändern,
• die Balance zwischen Wahrnehmung, Emotion und Kontrolle verschieben und
• dadurch langfristig die emotionale Selbstregulation beeinträchtigen können.
Gerade Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Belastungen im Jugendalter — mit erheblichen Folgen für Lernen, soziale Entwicklung und Lebensqualität.
Die Autorinnen und Autoren der Studie betonen, dass es nicht um eine Verteufelung von Medien geht, sondern um sensible Entwicklungsfenster. Besonders das Baby- und Kleinkindalter sei eine Phase, in der reale Sinneserfahrungen, Bewegung, Beziehung und Spiel nicht durch Bildschirmzeit verdrängt werden sollten.
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt weiterhin:
• unter 2 Jahren: keine Bildschirmzeit,
• 2–5 Jahre: maximal eine Stunde täglich, möglichst begleitet, wobei die Stunde eher für die Fünfjährigen und deutlich weniger für die Zweijährigen gilt.
Neue neurobiologische Gründe für den Hirnentwicklungsschutz
Die neue Studie liefert nun weitere neurobiologische Gründe, diese Empfehlungen äußerst ernst zu nehmen.
Diese Forschung zeigt eindrücklich: Frühe Mediennutzung wirkt tiefer und langfristiger, als wir lange angenommen haben. Bildschirmzeit im Baby- und Kleinkindalter beeinflusst nicht nur Verhalten, sondern die Struktur und Vernetzung des Gehirns — mit möglichen Folgen bis in die Pubertät.
Für Eltern, pädagogische Fachkräfte und Bildungspolitik bedeutet das: Frühkindliche Bildung ist immer auch Hirnentwicklungsschutz.
Mehr zur Studie finden Sie hier.
Gernot Körner