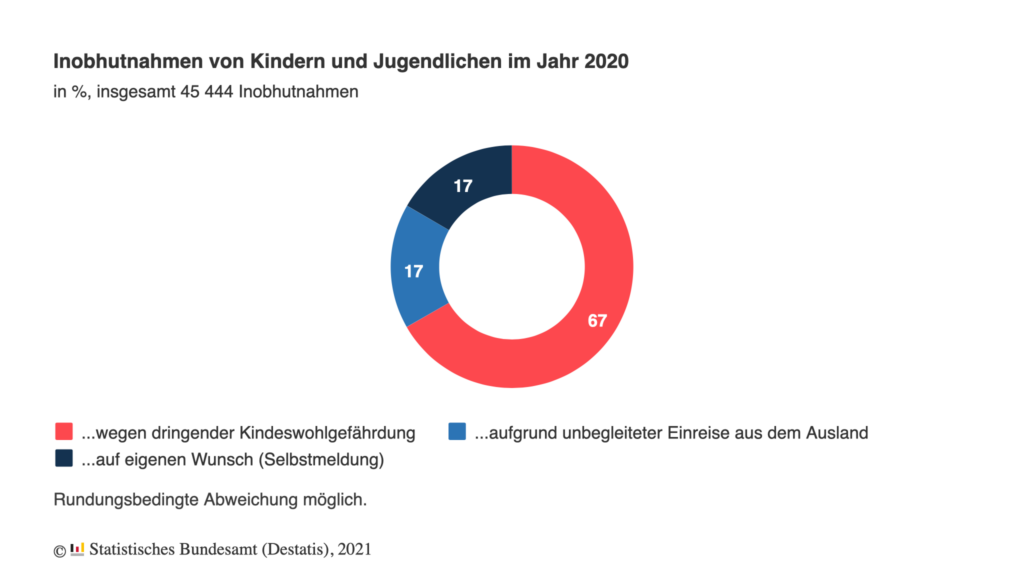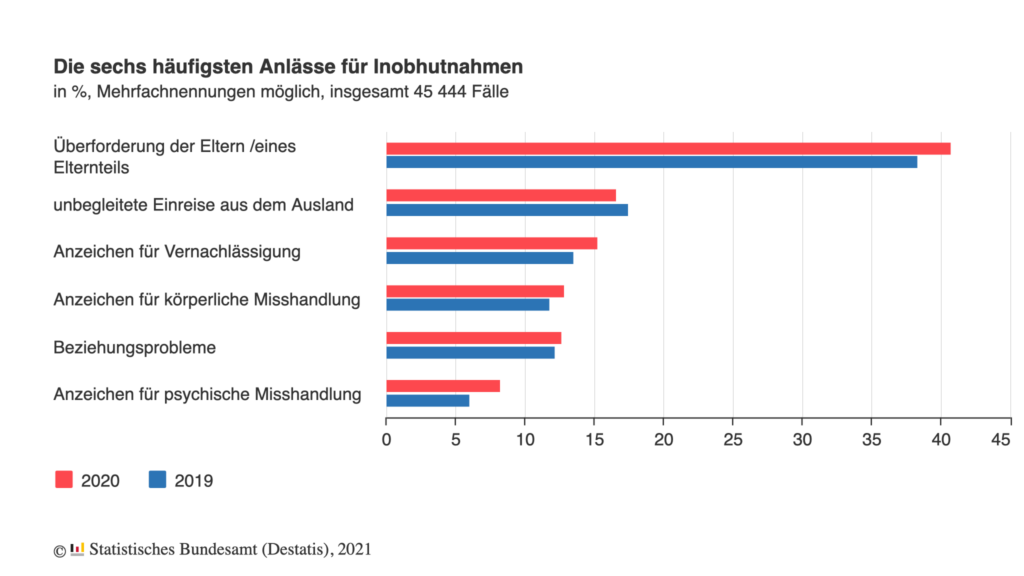Misshandlung in der Kindheit schwächt das Körpergefühl

Studie zeigt: Wer als Kind emotional verletzt wurde, hat oft weniger Vertrauen in den eigenen Körper
Eine neue Auswertung von Studien zeigt: Menschen, die als Kinder seelisch misshandelt oder vernachlässigt wurden, vertrauen ihrem Körper oft weniger. Das bedeutet, dass sie innere Signale wie Herzklopfen, Hunger oder Anspannung nicht so gut wahrnehmen und deuten können wie andere.
Diese Fähigkeit, den eigenen Körper von innen zu spüren, spielt eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden. Sie hilft dabei, mit Gefühlen und Stress umzugehen und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Wenn dieses Körpergefühl gestört ist, kann das auch später im Leben Probleme machen.
Weniger Körpervertrauen kann seelische Krankheiten begünstigen
Die Forscherinnen und Forscher berichten: Wer in der Kindheit seelisch vernachlässigt oder beleidigt wurde, hat oft Schwierigkeiten, die Signale des Körpers richtig einzuordnen. Das kann dazu führen, dass man Gefühle schlechter steuern kann, Stress schwerer verkraftet und die eigenen Grenzen nicht gut erkennt.
Die Folge: Das Risiko für seelische Erkrankungen wie Angst, Niedergeschlagenheit oder Essstörungen steigt. „Seelische Gewalt ist oft unsichtbar – aber sie hat starke Auswirkungen“, sagt Julia Ditzer, die Hauptautorin der Studie. Auch ihre Kollegin Dr. Ilka Böhm betont: „Diese Erfahrungen bleiben nicht ohne Folgen – auch wenn sie niemand sieht.“
Kinder brauchen auch Schutz für ihre Gefühle
Die Studienleiterin Prof. Dr. Anna-Lena Zietlow macht deutlich: „Kinder brauchen nicht nur Schutz vor Schlägen oder Übergriffen. Sie brauchen auch liebevolle Zuwendung, Aufmerksamkeit und echte Nähe.“
Zietlow und ihr Team hoffen, dass ihre Forschung dabei hilft, seelische Misshandlung und Vernachlässigung ernster zu nehmen – in der Öffentlichkeit, in der Forschung und in der Arbeit mit Familien.
So wurde die Untersuchung gemacht
Die Forschenden haben Ergebnisse aus 17 Einzelstudien zusammengetragen. Dabei wurden die Daten von 3.705 Personen ausgewertet. Ziel war herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen schlechter Behandlung in der Kindheit und einem gestörten Körpergefühl gibt – und welche Art von Misshandlung dabei am stärksten wirkt.
Die Untersuchung zeigt: Körperliche oder sexuelle Gewalt wirken sich weniger stark auf das Körpergefühl aus als seelische Misshandlung und Vernachlässigung. Das heißt: Wenn ein Kind oft ignoriert, beschimpft oder abgewertet wurde, kann es später Schwierigkeiten haben, auf seinen Körper zu hören.
Neue Studie mit Jugendlichen gestartet
Die Forscherinnen und Forscher wollen nun noch genauer hinschauen. In einer neuen Studie untersuchen sie gerade, wie sich schlechte Kindheitserfahrungen auf das Körpergefühl von Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren auswirken. Ziel ist es, mehr darüber zu lernen, wie solche Erfahrungen die Entwicklung junger Menschen beeinflussen.
Veröffentlicht wurde die Auswertung in der Fachzeitschrift „Nature Mental Health“.
Beteiligt sind Teams der Technischen Universität Dresden und der Freien Universität Berlin.
Originalpublikation:
Ditzer, J., Woll, C. F. J., Burger, C., Ernst, A., Boehm, I., Garthus-Niegel, S., & Zietlow, A.-L. (2025). Childhood maltreatment and interoception: A meta-analytic review. Nature Mental Health. DOI: https://www.nature.com/articles/s44220-025-00456-w
Gernot Körner