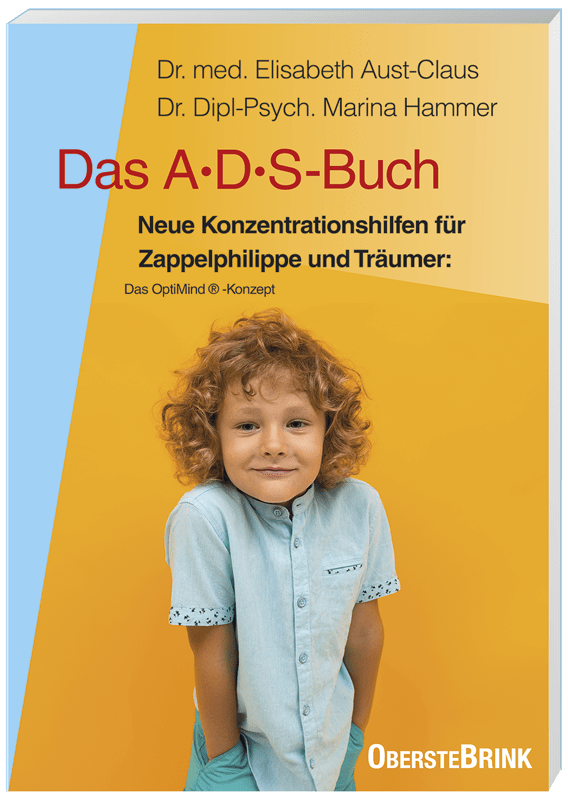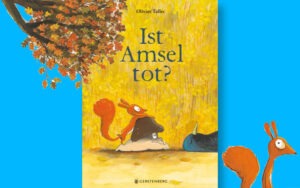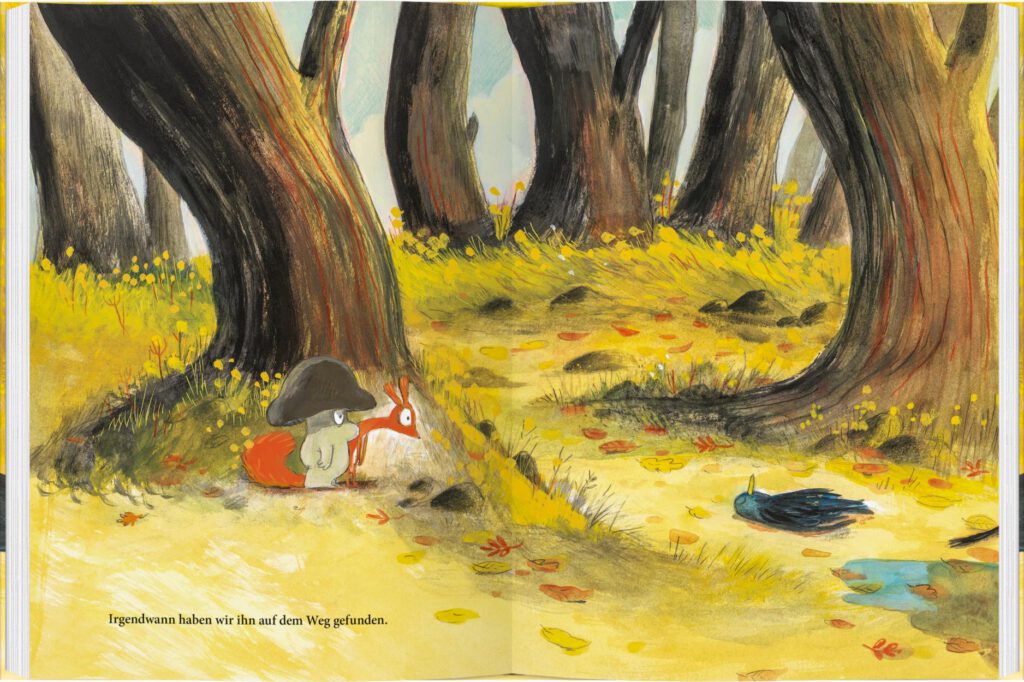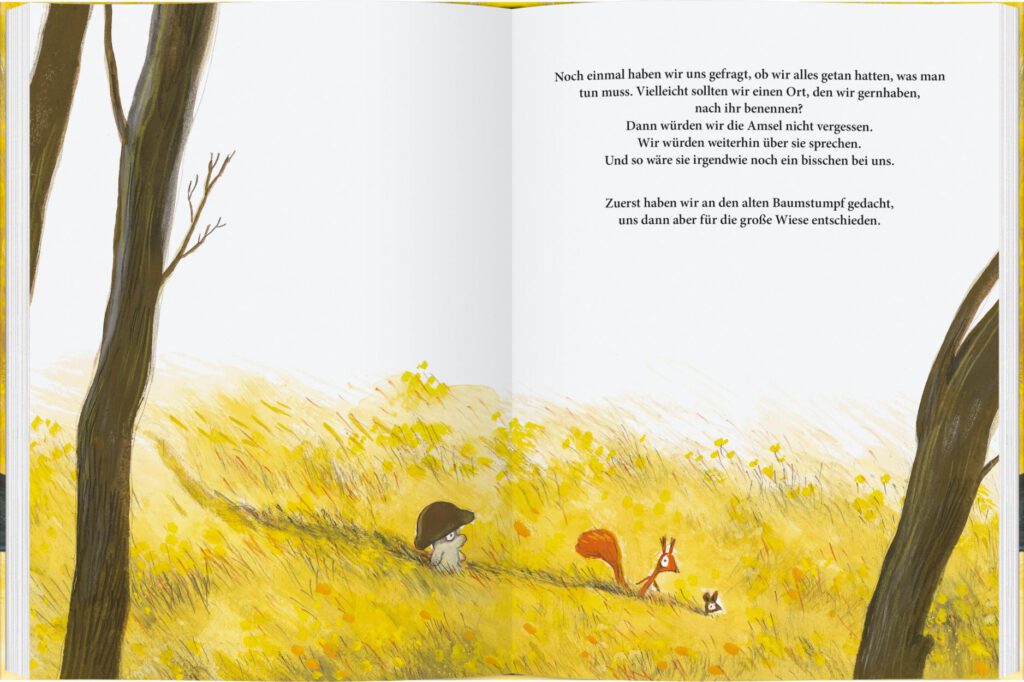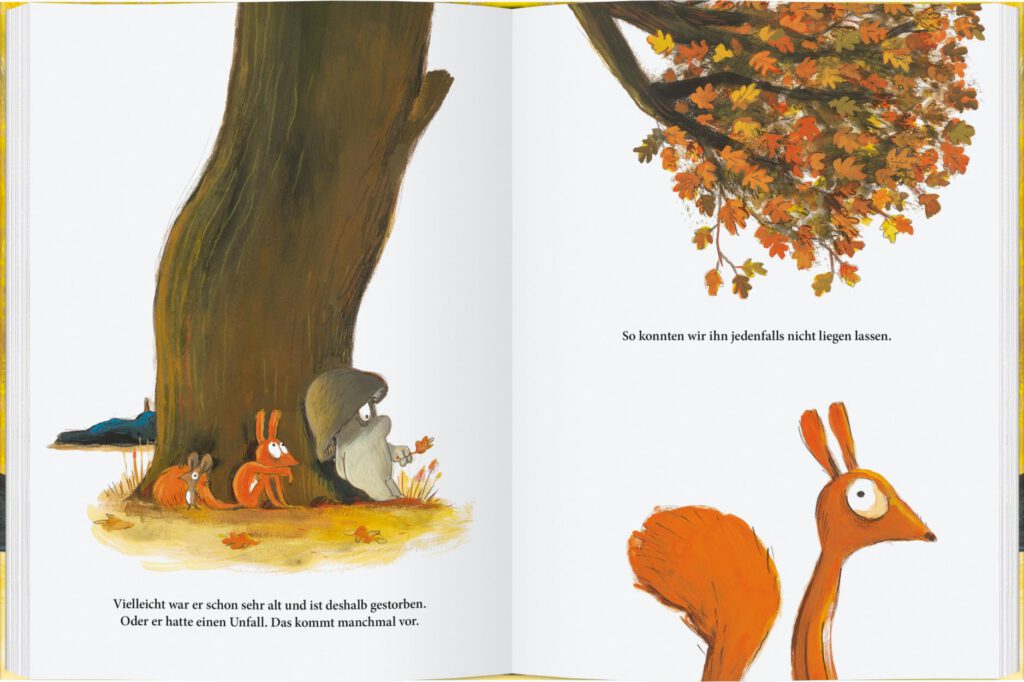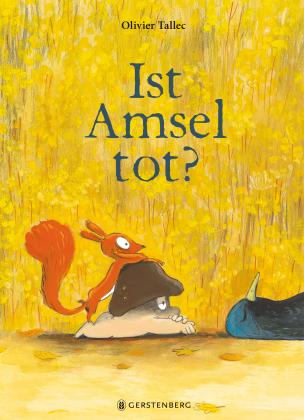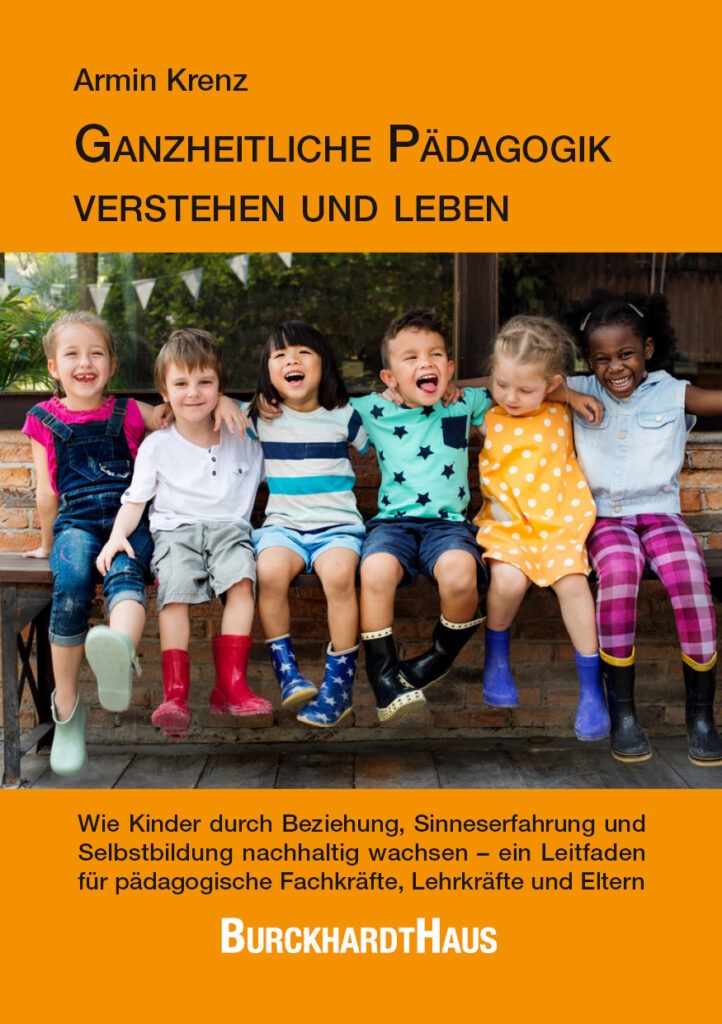Was Leitungskräfte, Teams und Träger konkret tun können, um autistische Kinder wirksam einzubeziehen
Inklusion ist längst ein erklärtes Ziel der frühkindlichen Bildung in Deutschland – doch in der Praxis bleibt sie häufig fragmentarisch. Zwar betreuen laut Statista inzwischen rund 41 Prozent aller Kindertageseinrichtungen Kinder mit Anspruch auf Eingliederungshilfe, gleichzeitig fühlen sich viele pädagogische Fachkräfte nicht ausreichend auf die Bedürfnisse neurodivergenter Kinder vorbereitet. Insbesondere autistische Kinder stoßen im Kita-Alltag weiterhin auf strukturelle, organisatorische und kulturelle Barrieren. Eine aktuelle empirische Untersuchung aus Hamburg zeigt nun, wo genau diese Barrieren liegen – und welche Stellschrauben tatsächlich geeignet sind, um Inklusion im Alltag wirksam umzusetzen.
Der Blick auf die Organisation statt nur auf das Kind
Im Zentrum der Studie steht nicht das einzelne Kind, sondern die Organisation Kita als Ganzes. Der entscheidende Befund: Inklusion gelingt nicht primär durch einzelne Fortbildungen oder zusätzliche Fachkräfte, sondern durch eine gezielte Veränderung der Organisationskultur – und diese wird maßgeblich von der Leitungsebene geprägt. Kita-Leitungen nehmen eine Schlüsselrolle ein, weil sie gleichzeitig pädagogische, organisatorische und kommunikative Verantwortung tragen und damit als Bindeglied zwischen Team, Träger, Familien und externen Unterstützungsstrukturen fungieren.
Diversitätskompetenz als strategische Aufgabe
Die Untersuchung zeigt, dass Leitungskräfte dann wirksam zur Inklusion beitragen können, wenn sie Diversitätskompetenz nicht als individuelles Merkmal einzelner Fachkräfte begreifen, sondern als strategische Entwicklungsaufgabe der gesamten Einrichtung. Diversitätskompetenz umfasst dabei mehrere Ebenen: Wissen über Neurodiversität und Autismus, die Fähigkeit zur kritischen Reflexion normativer Vorstellungen von „Normalität“, eine diskriminierungssensible Haltung sowie konkrete Kompetenzen zur Anpassung von Strukturen, Routinen und Kommunikationsformen im Kita-Alltag.
Strukturelle Barrieren entstehen oft unbeabsichtigt
Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass viele strukturelle Barrieren nicht aus fehlendem guten Willen entstehen, sondern aus institutionellen Routinen, die nie für Vielfalt konzipiert wurden. Starre Tagesabläufe, laute Gruppenräume, wenig Rückzugsmöglichkeiten, normierte Entwicklungsraster oder defizitorientierte Förderlogiken können für autistische Kinder hoch belastend wirken und ihre Teilhabe erheblich einschränken. Inklusion bedeutet daher nicht, einzelne Kinder „passend zu machen“, sondern die Umgebung so zu gestalten, dass unterschiedliche Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Verhaltensweisen gleichberechtigt Platz haben.
Leitungskräfte als Motor für kulturellen Wandel
Besonders deutlich wird in der Untersuchung, dass Leitungskräfte eine entscheidende Rolle dabei spielen, diese Perspektivverschiebung im Team zu verankern. Sie entscheiden darüber, ob Inklusion als Zusatzaufgabe unter Zeitdruck erlebt wird – oder als Qualitätsmerkmal professioneller pädagogischer Arbeit. Sie setzen Prioritäten, ermöglichen Fortbildungszugänge, schaffen Reflexionsräume im Team und verhandeln mit Trägern und Behörden über Ressourcen, Zuständigkeiten und Rahmenbedingungen.
Engagement stößt an strukturelle Grenzen
Gleichzeitig macht die Studie sichtbar, dass selbst engagierte Leitungen an strukturelle Grenzen stoßen. Zeitmangel, Personalknappheit, finanzielle Restriktionen und administrative Anforderungen begrenzen den Handlungsspielraum erheblich. Viele Leitungskräfte erleben einen Zielkonflikt zwischen pädagogischem Anspruch und organisatorischer Realität. Inklusion wird dadurch nicht selten zur zusätzlichen Belastung, statt als integraler Bestandteil professioneller Praxis wahrgenommen zu werden.
Der Umgang mit Autismus prägt Teilhabechancen
Ein weiterer zentraler Befund betrifft den gesellschaftlichen und institutionellen Umgang mit Autismus. Trotz wachsender öffentlicher Aufmerksamkeit sind autistische Kinder in vielen pädagogischen Kontexten weiterhin mit defizitorientierten Zuschreibungen konfrontiert. Die Studie zeigt, dass diese Zuschreibungen nicht nur das pädagogische Handeln beeinflussen, sondern auch die Erwartungen an Kinder und Familien prägen – und damit Teilhabemöglichkeiten strukturell begrenzen. Inklusion erfordert daher nicht nur organisatorische Anpassungen, sondern auch eine bewusste Auseinandersetzung mit eigenen Haltungen, Deutungsmustern und Machtverhältnissen im Bildungssystem.
Was Kitas konkret tun können
Aus den Ergebnissen lassen sich mehrere konkrete Handlungsempfehlungen ableiten: Erstens braucht Inklusion eine klare strategische Verankerung auf Leitungsebene. Zweitens müssen Reflexions- und Lernräume für Teams institutionalisiert werden, um Unsicherheiten, Vorurteile und Überforderungen bearbeiten zu können. Drittens ist eine enge Kooperation mit Familien essenziell, da sie über unverzichtbares Wissen über die Bedürfnisse ihrer Kinder verfügen. Und viertens braucht es auf struktureller Ebene deutlich mehr politische und institutionelle Unterstützung, um Inklusion nicht nur zu fordern, sondern auch realistisch zu ermöglichen.
Inklusion als dauerhafter Entwicklungsprozess
Insgesamt zeigt die Hamburger Untersuchung: Inklusion ist kein Zustand, der einmal erreicht und dann verwaltet wird, sondern ein fortlaufender Entwicklungsprozess. Sie entsteht dort, wo Organisationen lernfähig bleiben, Vielfalt nicht als Abweichung, sondern als Normalität begreifen und bereit sind, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen. Hamburgs Kitas verfügen über engagierte Fachkräfte und Leitungsteams – doch ohne strukturelle Entlastung, klare politische Rahmenbedingungen und eine konsequente Abkehr von defizitorientierten Denkmodellen bleibt Inklusion fragil.
Die Forschung macht deutlich: Wer echte Teilhabe in der frühkindlichen Bildung will, muss nicht zuerst die Kinder verändern, sondern die Systeme, in denen sie aufwachsen.
Weitere Informationen zu Gleichstellung und Diversität an der IU unter: https://www.iu.de/hochschule/diversity-und-gleichstellung/
Gernot Körner