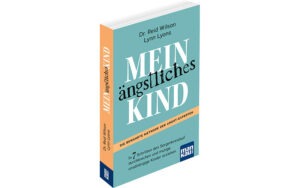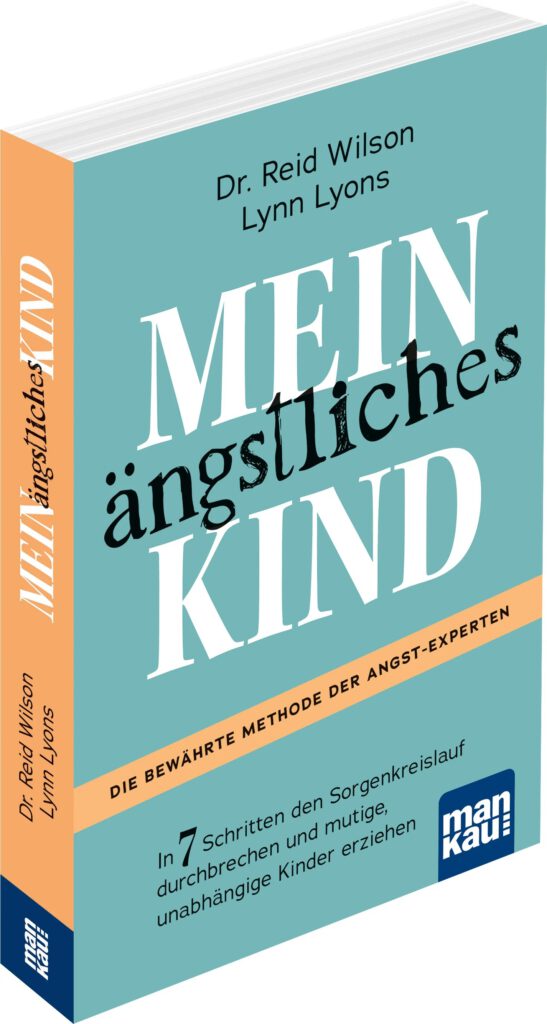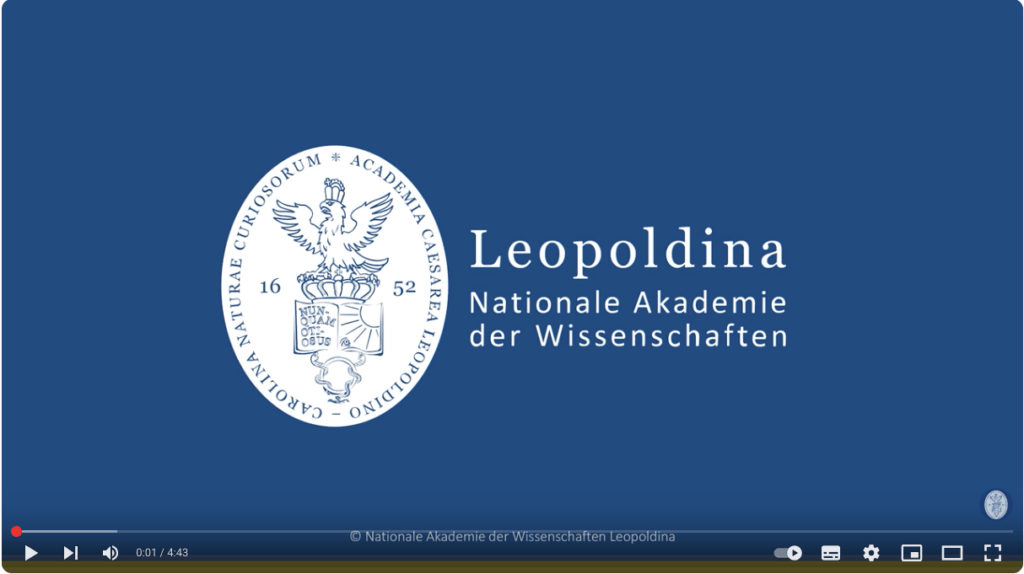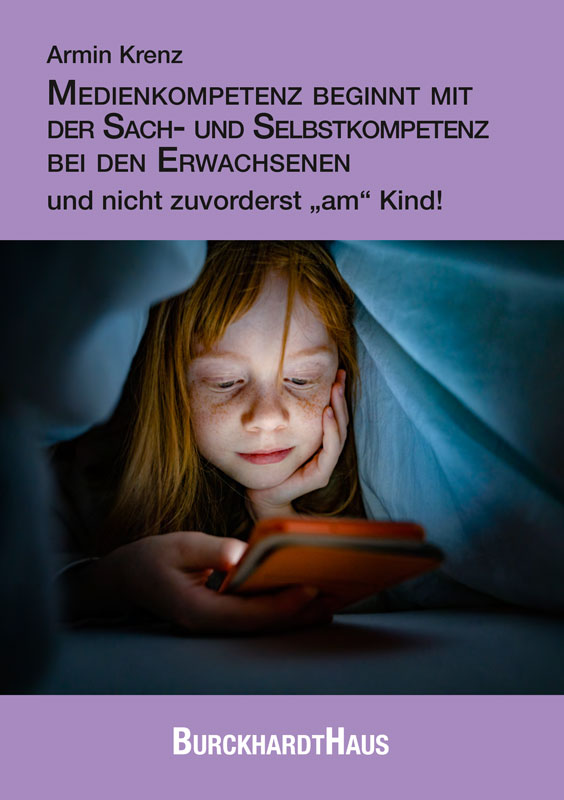Wenn das Gewicht auf der Seele lastet: Übergewicht und Psyche bei Kindern

Neue Studien zeigen: Übergewicht belastet nicht nur den Körper, sondern erhöht auch das Risiko für Depressionen und Ängste
Übergewicht bei Kindern ist seit Jahren ein Thema in der Gesundheits- und Bildungspolitik. Meist stehen dabei Ernährung, Bewegung und medizinische Folgen im Vordergrund. Doch neue wissenschaftliche Erkenntnisse machen deutlich: Übergewicht belastet nicht nur den Körper – es kann auch die seelische Gesundheit von Kindern erheblich beeinträchtigen.
Darauf weist die Stiftung Kindergesundheit in einem aktuellen Newsletter hin. Studien zeigen, dass übergewichtige Kinder und Jugendliche deutlich häufiger unter psychischen Problemen leiden als normalgewichtige Gleichaltrige. Besonders depressive Symptome, Angststörungen und Verhaltensauffälligkeiten treten verstärkt auf. Damit wird klar: Wer Prävention ernst nimmt, muss nicht nur Kalorien und Bewegung betrachten, sondern auch die psychische Dimension von Übergewicht.
Erhöhtes Risiko für Depressionen und Angststörungen
Besorgniserregend ist vor allem der Zusammenhang zwischen Übergewicht und depressiven Entwicklungen im Jugendalter. Während Mädchen generell häufiger zu depressiven Symptomen neigen, zeigen die Daten bei Jungen einen besonders alarmierenden Effekt: Übergewichtige 14-jährige Jungen haben ein fünffach erhöhtes Risiko, innerhalb weniger Jahre klinisch relevante depressive Symptome zu entwickeln.
Auch aggressive Verhaltensweisen können mit zunehmendem Alter häufiger auftreten. Erschreckend ist zudem, dass psychische Belastungen oft bestehen bleiben – selbst dann, wenn sich das Körpergewicht später wieder normalisiert. Übergewicht hinterlässt also nicht nur körperliche Spuren, sondern kann langfristig auch die emotionale Entwicklung beeinflussen.
Mobbing und Ausgrenzung verstärken die Belastung
Ein entscheidender Faktor ist die soziale Dimension. Übergewichtige Kinder erleben deutlich häufiger Hänseleien, Mobbing und Ausgrenzung. Diese Erfahrungen verstärken die seelische Belastung und können noch Jahre später nachwirken.
Expertinnen und Experten betonen deshalb die Dringlichkeit frühzeitiger Maßnahmen gegen gewichtsbezogenes Mobbing – insbesondere in Schulen und Bildungseinrichtungen. Prävention bedeutet hier nicht nur Gesundheitsförderung, sondern auch die Schaffung eines respektvollen sozialen Umfelds, in dem Kinder nicht stigmatisiert werden.
Soziale Ungleichheit verschärft das Problem
Besonders stark betroffen sind Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung bestätigt, dass Kinder aus Familien mit geringem Einkommen und niedrigerem Bildungsniveau nicht nur häufiger übergewichtig sind, sondern auch häufiger emotionale Probleme entwickeln.
Die Forschenden untersuchten über 4.600 Kinder in den Niederlanden und fanden heraus, dass ein erheblicher Teil der psychischen Belastungen in diesen Familien direkt mit dem häufigeren Auftreten von Übergewicht zusammenhängt. Ursachen sind neben unausgewogener Ernährung auch eingeschränkte Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten sowie ein erhöhtes Stressniveau im familiären Umfeld.
Ganzheitliche Prävention statt einseitiger Maßnahmen
Die Stiftung Kindergesundheit fordert daher ein Umdenken. Prävention darf sich nicht allein auf Ernährung und Bewegung konzentrieren. Vielmehr müssen soziale und psychische Komponenten stärker berücksichtigt werden.
Prof. Dr. Berthold Koletzko, Vorsitzender der Stiftung, betont: Kinder seien nicht nur passive Patientinnen und Patienten, sondern aktive Beteiligte ihrer eigenen Gesundheitsversorgung. Sie profitieren von verständlicher Information und echter Mitsprache. attachmentdata121919
Die Stiftung empfiehlt gezielte Maßnahmen, die sowohl körperliche als auch psychische Aspekte berücksichtigen:
- Gestaltung gesundheitsförderlicher Lebensräume in Bildungseinrichtungen
- Programme gegen Ausgrenzung und für ein positives Körperbild
- Frühzeitige psychologische Begleitung und niedrigschwellige Hilfen
Nur ein gesellschaftlicher Ansatz, der strukturelle Faktoren einbezieht, kann langfristig wirksam sein.
Innovative Projekte: Powerkids und #starkWieWir
Neben klassischen Aufklärungskampagnen entwickelt die Stiftung Kindergesundheit auch innovative Formate, die Kinder direkt erreichen. Ein Beispiel ist die App Powerkids, die sich an übergewichtige Kinder zwischen acht und zwölf Jahren richtet. Spielerisch vermittelt sie über zwölf Wochen Impulse zu Ernährung, Bewegung und Selbstwert.
Auch die Mitmach-Challenge #starkWieWir verbindet Gesundheitsbildung auf Augenhöhe mit kreativen Materialien und dokumentarischen Filmen, in denen Kinder selbst zu Vorbildern für einen gesunden Alltag werden. Die Filme und Arbeitsblätter sind in der Mediathek der Stiftung verfügbar.
Körper und Seele gemeinsam in den Blick nehmen
Übergewicht im Kindesalter ist ein komplexes Thema, das weit über Ernährung hinausgeht. Die aktuellen Studien machen deutlich: Psychische Gesundheit, soziale Teilhabe und der Schutz vor Ausgrenzung müssen integraler Bestandteil jeder Präventionsstrategie sein.
Kinder brauchen nicht nur Bewegung und gesunde Mahlzeiten, sondern auch Anerkennung, Unterstützung und ein Umfeld, das sie stärkt – körperlich wie seelisch. Nur so kann Prävention wirklich gelingen.