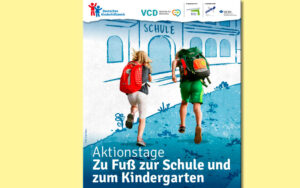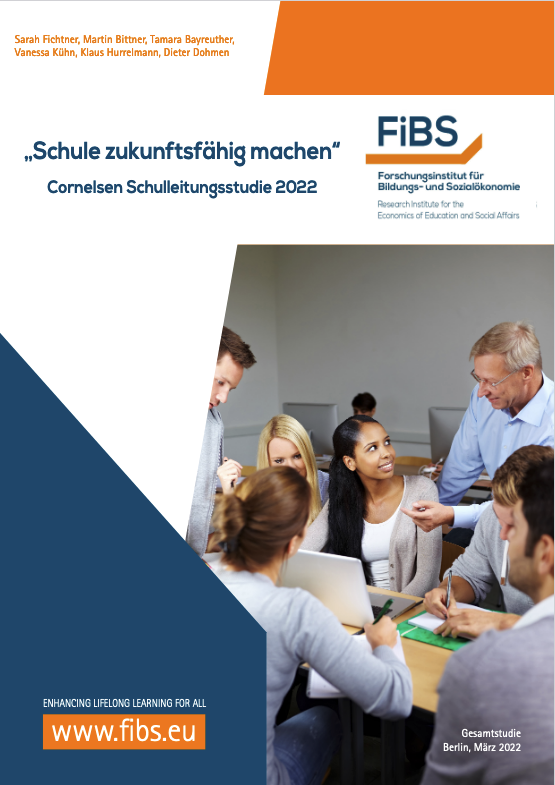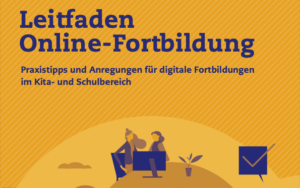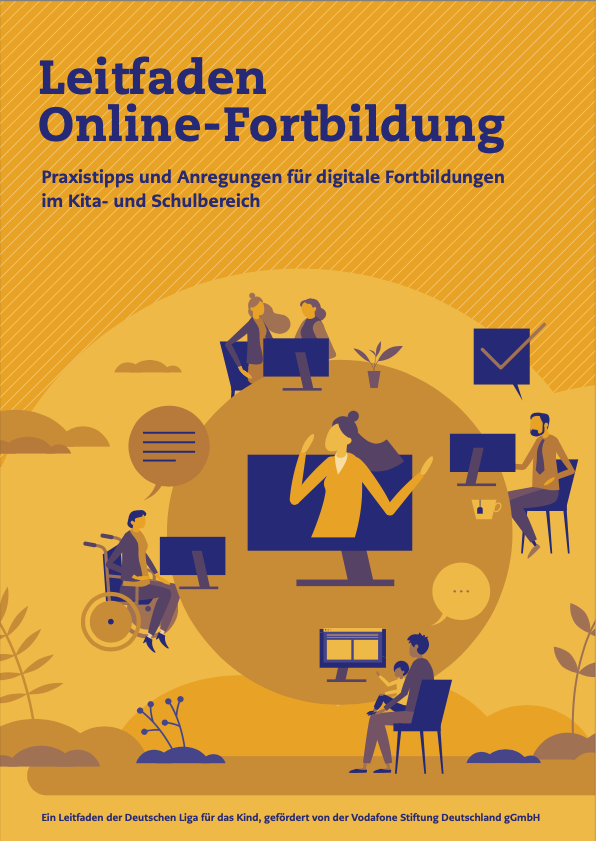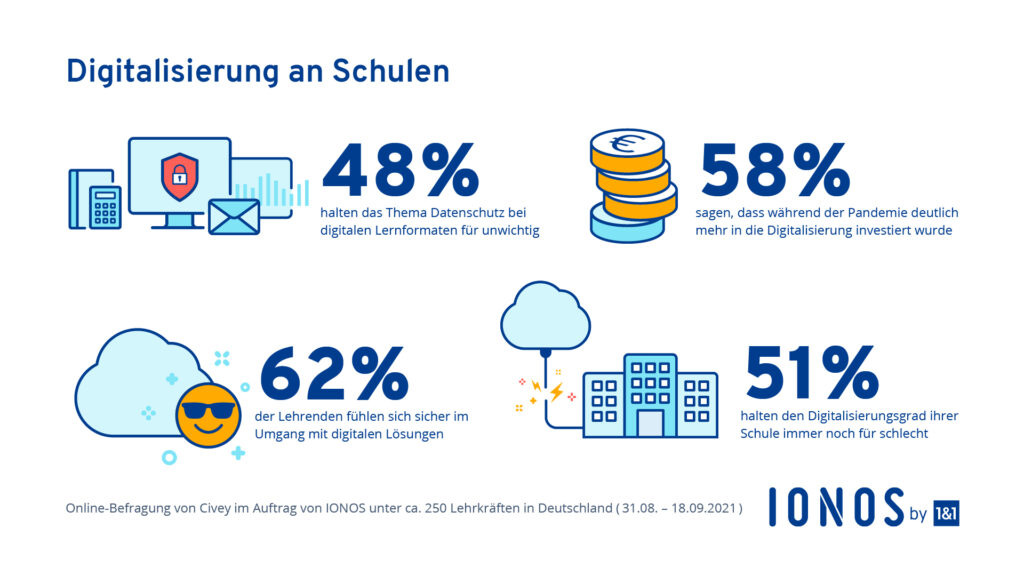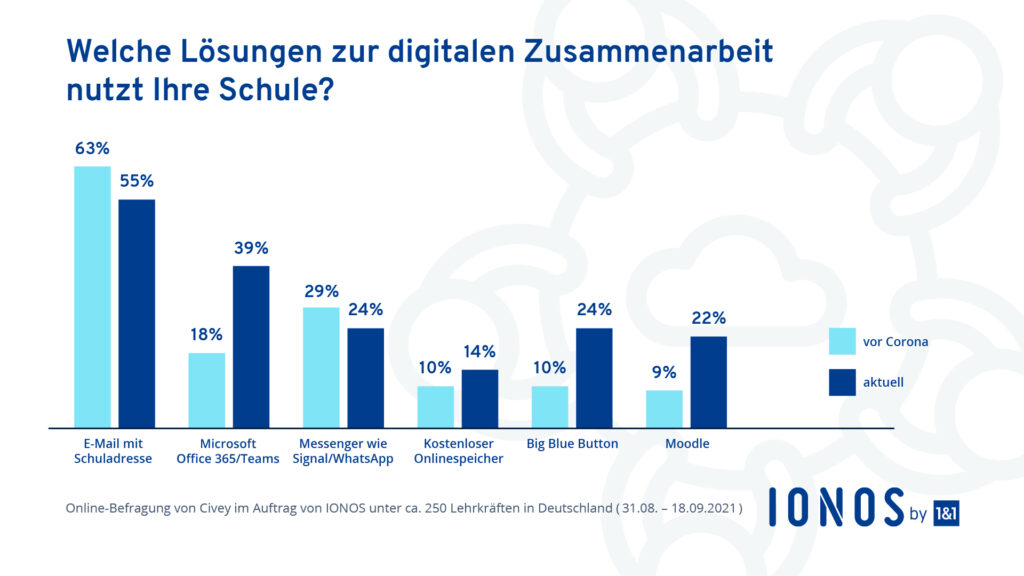Wie Faulheit, Eitelkeiten, Profitinteressen und Dummheit zukunftsorientierte Bildung verhindern
Über Bildung lässt sich wunderbar diskutieren. Dabei herrscht landläufig die Meinung, wer in der Schule und neuerdings auch im Kindergarten recht viel lernt, aus dem wird ein gebildeter Mensch. Der Erwerb von wertvollem Wissen gilt als mühsam. Nur, was mit Schweiß und Tränen eingetrichtert wurde, scheint bedeutend. Insofern konnte die Schlussfolgerung aus den schwachen Ergebnissen der so genannten PISA-Studie zur Jahrtausendwende auch nur lauten, dass die Kinder in der Schule eben nicht genug gelernt hätten.
Bildung landläufig gesehen
Hand aufs Herz. Vielerorts ist das die landläufige Meinung, wenn es um Bildung und Schule geht. Dabei hat schon Titus Petronius im alten Rom geklagt, dass die Jugend in den Schulen verdummen würde, weil sie nichts von dem zu hören bekäme, was sie im Alltag brauche. Das ist 2000 Jahre her. Dass sich daran nicht viel geändert hat, zeigen etwa die kritischen Äußerungen des populären Philosophen Richard David Precht. Für ihn hat der heutige Schulbetrieb nur wenig mit sinnvoller, zukunftsgerichteter Vermittlung von Bildung zu tun.
Das Frühstück bleibt vielen Kindern im Halse stecken. Einzige Möglichkeit, das zu verhindern, wäre in den meisten Fällen: sie von der Schulpflicht zu befreien.
Christine Nöstlinger
Auch dass sich Bildung nicht eintrichtern lässt, ist schon länger bekannt. „Lehren heißt, ein Feuer entfachen, und nicht einen leeren Eimer füllen“, schrieb vor 2500 Jahren der griechische Philosoph Heraklit. Eine Erkenntnis, die heute durch die moderne Hirnforschung verbunden mit den bildgebenden Verfahren längst belegt ist.
Was aus uns werden könnte
Warum handeln wir dann trotz besseren Wissens anders und reden über Bildung, als gälte es, einen störrischen Esel zur Futterkippe zu zerren? Eine Antwort lautet ganz einfach: „Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht!“ Schließlich haben nur wenige von uns einen Bildungsprozess erlebt, wie er nach allen Erkenntnissen sinnvoll wäre. Der bekannte Hirnforscher Gerald Hüther betont in seinen Vorträgen immer wieder, dass wir uns nicht damit trösten sollten, dass aus uns doch aus etwas geworden wäre. Viel wesentlicher sei die Frage, was aus uns hätte werden können.
Eines der größten Probleme unserer Zeit ist, dass viele geschult aber wenige gebildet sind.
Thomas Morus
Angesichts der enormen Probleme, vor denen die Menschheit heute steht, erscheint diese Frage noch viel dringlicher. Was bedeutet Bildung heute? Wie muss eine moderne Bildung aussehen, die uns darin unterstützt, die anstehenden Aufgaben zu erfüllen?
Muss Schule liefern?
Um das zu beantworten, ist es naheliegend, in einer so genannten „Leistungsgesellschaft“ von den Aufgaben her zu denken. Ganz abgesehen davon, dass ein gebildeter Mensch schon dem widersprechen würde, dass wir es hierzulande mit einer „Leistungsgesellschaft“ zu tun haben, sondern eher um eine Erben- oder Geldgesellschaft, zeigt sich bereits nach den ersten Versuchen, dass sich der Bildungsbegriff von Seiten der Anforderungen her gar nicht wirklich erschließen lässt. Ein beliebtes Argument ist, dass die Schule das abliefern müsse, womit „die Wirtschaft“ etwas anfangen könne.
Schule ist jenes Exil, in dem der Erwachsene das Kind solange hält, bis es imstande ist, in der Erwachsenenwelt zu leben, ohne zu stören.
Maria Montessori
Dazu hat unter anderem die Kultusministerkonferenz (KMK) die Bildungsstandards formuliert. Deutsch und Mathematik sind mit dabei, später die Erste Fremdsprache. Naturwissenschaften wie Biologie und Physik kommen hinzu. Reicht das? „Natürlich nicht“, antworten etwa die Verfechter der digitalen Bildung und fordern mittlerweile schon einen DigitalPakt KiTa. „Natürlich nicht“, werden die Demokraten in unserem Land sagen. Schließlich braucht eine Demokratie mündige Bürger. „Natürlich nicht“, behaupten die Pädagogen, die danach fragen, wo denn der Mensch bei all dem bleibe.
Bildung beginnt beim Fötus
Bevor wir nun weiter diesen Irrweg gehen, auf dem wir noch einer Fülle von Anforderungen begegnen, die weder ein noch so gutes Bildungssystem noch ein von ihm gebildeter Mensch leisten kann, müssen wir uns weiter in die Tiefe des menschlichen Seins begeben. Denn wer Bildung richtig vorantreiben möchte, darf nicht vergessen, dass er es mit lebendigen Wesen und ihren Eigenheiten zu tun hat.
Dabei hilft es, sich klar zu machen, dass das Wort Bildung vom althochdeutschen Wort „bildunga“ kommt, was in etwa so viel bedeutet, wie Vorstellung oder Vorstellungskraft. Je größer die Bildung, desto größer ist die Vorstellungskraft von den Zusammenhängen der Dinge dieser Welt. Damit beginnt Bildung schon beim Fötus im Mutterleib, auch wenn sich das ein wenig seltsam anhört.
Vom Streben nach Erkenntnis
Aber schon gegen Ende der Schwangerschaft strebt der Mensch nach Erkenntnis und damit der Entwicklung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten. Schließlich geht es darum, sich im Leben zurecht zu finden und erfolgreich zu sein. Erfolg bedeutet dabei, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Spätestens ab seiner Geburt gestaltet ein Kind sein eigenes Bildungsprogramm. Auch das ist wissenschaftlich belegt und seit der griechischen Antike bekannt. Das Kind beginnt, sich die Welt anzueignen.
Die größte Gefahr bei diesem Entwicklungsprozess besteht darin, dass wir es dabei stören, statt es darin zu unterstützen. Schon die chinesischen Weisen Konfuzius und Laotse kannten den Weg und wurden durch ein Heer von Pädagogen, Psychologen und Naturwissenschaftlern bis zum heutigen Tage bestätigt. Warum wir es dennoch anders angehen, hat damit zu tun, dass wir versuchen Kinder uns und unserem fiktiven Bild von Welt anzupassen. Und oftmals kommt noch ein ordentliches Stück Unverständnis und Faulheit hinzu, manchmal auch das Profitinteresse.
Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.
Friedrich Nietzsche
Immer wieder ist davon die Rede, dass die jungen Menschen im Bildungssystem geformt werden müssten. Wie absurd und vermessen das ist, zeigt sich schon, wenn man die verschiedenen Interessen, die an die junge Generation gestellt werden, sich genauer ansieht. Diese sind so widersprüchlich, dass nur ein psychisch kranker Geist daraus entstehen könnte.
Ausgangspunkt muss der Mensch sein
Ein erfolgreiches Bildungssystem muss immer vom individuellen Menschen ausgehen, ihn verstehen und ernst nehmen. Wer das nicht versteht, dem sei der Ausspruch eines Genies wie Albert Einstein ans Herz gelegt: „Jeder ist ein Genie! Aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist.“ Leider läuft unser Bildungssystem vom Tage unserer Geburt an in weiten Teilen in diese Richtung und gipfelt darin, unter dem Vorwand der individuellen Förderung, unsere Schulsystem in drei- bis viergliedrig Schultypen zu unterteilen. Angesichts der sehr unterschiedlichen Entwicklung der Menschen in ihren ersten 20 Lebensjahren ist dies schlcht völliger Unsinn.
Es ist deshalb nötig, dass wir dem Kind die Möglichkeit geben, sich in Übereinstimmung mit den Gesetzen seiner Natur so zu entwickeln, dass es stark werden kann und, wenn es stark geworden ist, sogar noch mehr tun kann, als wir zu hoffen gewagt haben.
Maria Montessori
Dabei steckt die Begeisterung für die Zusammenhänge dieser Welt tief ins uns allen. „Es ist deshalb nötig, dass wir dem Kind die Möglichkeit geben, sich in Übereinstimmung mit den Gesetzen seiner Natur so zu entwickeln, dass es stark werden kann und, wenn es stark geworden ist, sogar noch mehr tun kann, als wir zu hoffen gewagt haben“, schreibt Maria Montessori. „Denn nur für das, was einem Menschen wichtig ist, kann er sich auch begeistern, und nur wenn sich ein Mensch sich für etwas begeistert, werden all jene Netzwerke ausgebaut und verbessert, die der betreffende Mensch in diesem Zustand der Begeisterung nutzt. Zwanzig bis fünfzig Mal am Tag erlebt ein Kleinkind diesen Zustand. Jeder dieser kleinen Begeisterungsstürme führt gewissermaßen dazu, dass im Hirn die Gießkanne mit dem Dünger angestellt wird, der für alle Wachstums- und Umbauprozesse von neuronalen Netzwerken gebraucht wird“, erklärt Hüther den inneren Bildungsprozess, durch den etwa der so wichtige Forschergeist in uns geweckt wird. „Alle Bildung ist Selbstbildung“, stellte einst Edith Stein fest. Und Maria Montessori vermutete, wenn wir unseren Kindern vertrauen und sie sich entfalten lassen würden, könnte daraus einst eine bessere Welt entstehen.
Handwerkszeug statt Teilwissen
Wir wissen nicht, was die Zukunft eines Tages von unseren Kindern abverlangen wird. Der Pädagoge Jean-Jacques Rousseau äußerte sein Unverständnis für jene Menschen, die ihre Kinder für eine Zukunft quälten, die sie doch gar nicht kennen. Ein schönes Beispiel sind jene, die Kleinkinder heute schon mit Tablets ausstatten möchten, um sie digital fit zu machen, und dabei vergessen, dass diese Tablets spätestens in zehn Jahren im Museum liegen.
Wer Kleinkinder heute schon mit Tablets ausstatten möchte, um sie digital fit zu machen, vergisst, dass diese Tablets spätestens in zehn Jahren bestenfalls im Museum liegen
Dabei wissen die wenigsten wirklich was sie meinen, wenn sie von digitaler Bildung sprechen. Einige verweisen etwa darauf, dass schon Kleinkinder eine bessere Feinmotorik entwickeln, wenn sie viel mit den Smartphones ihrer Eltern spielen. Das ist auch tatsächlich so. Dabei ignorieren sie aber nicht nur die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Schutz der Kinder, sondern eben auch, dass einseitige Förderung in einem Teilgebiet zwar gewöhnlich zu einer Verbesserung in der Leistung in diesem Bereich führt, diese aber auf Kosten der Entwicklung anderer Fertigkeiten und Fähigkeiten geht. Hier gibt es so gut wie keine Forschung, aber so genannte Wissenschaftler:innen, die es kaum schaffen, zwischen ihren wissenschaftlichen Interessen und denen wirtschaftlichen Interessen ihres eigenen Unternehmens zu unterscheiden. Während andere wiederum meinen, sie müssten „modern“ sein und in Aktionismus verfallen. Wiederum andere verwechseln ihr gut gemeintes Engagement schlicht mit ihrem Geldbeutel, während die nächsten meinen, sie müssten die Kinder fit machen, für die veränderten Umstände.
Damit trampeln viele über die eigentlichen Bedürfnisse der Kinder hinweg und schaden ihnen, statt einer ernsthaften Wissenschaft Raum zu bieten, die letztlich auch zu einer sinnvollen „digitalen Bildung“ führt. Augenblicklich besteht diese mehr darin, den Erwachsenen zunächst mal einen vernünftigen Umgang mit ihren digitalen Gerätschaften nahe zu bringen und die Schülerinnen und Schüler in ihrem Interesse an dieser faszinierenden Welt ernsthaft dann zu unterstützen, wenn ihr Interesse vorhanden ist und diese zumindest lesen können.
Ja, sind die denn verrückt, diese Erwachsenen, dass sie unsere Jüngsten in einem Alter in die Schule schicken wollen, da sie doch so viel zu lernen haben?
Weisheit aus dem Himalaja
Es geht darum, Bildung so zu entwickeln, dass der Mensch je nach seiner Individualität seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, damit die Gesellschaft als Ganzes das Handwerkszeug in Händen dazu erhält, mit dem sie eine schwierige und komplexe Zukunft gestalten kann.
Kreativität ist gefragt
„Wo Deine Gaben liegen, da liegen Deine Aufgaben“, lautet ein altes deutsches Sprichwort. Wir brauchen heute kein Heer an Industriearbeitern und Soldaten mehr, die alle die gleichen Fähigkeiten haben. Und Konsumenten mögen zwar ihre Befriedigung aus dem Konsum ziehen, sind aber in Zeiten der Klimakrise auch zunehmend weniger gefragt. Wir brauchen Menschen, die mit ihren besonderen Fähigkeiten, die Herausforderungen der Zukunft meistern.
Der Philosoph Hans Lenk nennt dafür zwölf Bildungsziele: Kreativität, Flexibilität, Selbsterkenntnis, Selbstwertbewusstsein, Führungsfähigkeit, Sachlichkeit, Zielstrebigkeit, interdisziplinäre Offenheit, generalistisches Interesse, Fortschrittsorientierung, Zivilcourage, Grundwertorientierung. Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Klafki nennt drei Fähigkeiten: Selbstbestimmungsfähigkeit, Mitbestimmungsfähigkeit, Solidaritätsfähigkeit.
Kreativität ist eine Haltung im Leben, eine Fähigkeit jedwede Gegebenheit der Existenz zu meistern.
Arno Stern
Dabei beschreiben Lenk und Klafki nicht anderes als das, was der Mensch letztlich seit Entstehung des Homo sapiens sapiens eigentlich ist, wenn man ihn nur lässt. Denn genau diese Fähigkeiten haben dafür gesorgt, dass sich die Menschheit immer wieder aufs neue den neuen Umweltbedingungen angepasst und Lösungen für die Herausforderungen gefunden hat. Dass diese Lösungen nicht immer optimal waren, zeigt sich an vielen Beispielen. Wurde das Auto kurz nach seiner Erfindung doch als großer Fortschritt für die Umwelt gefeiert, weil dadurch der Pferdekot, der sich meterhoch am Straßenrand in den Städten sammelte, verschwand. Heute hat sich die Einstellung gegenüber dem Automobil oftmals ins Gegenteil gewendet.
Auch dafür kann die Menschheit Lösungen finden. Und man muss kein Prophet sein, um voraus zu sagen, dass es die kreativen, flexiblen und offenen Köpfe sein werden, die diese finden. Während jene, die einfache Lösungen bevorzugen, weil sie die Komplexität der Realität nicht erfassen können und wollen, diese nicht verstehen und möglicherweise verhindern werden. Wer dabei die Oberhand gewinnt, lässt sich noch nicht sagen. Letztlich sollte aber allen klar sein, dass wir jene kreativen Köpfe fördern sollten.
Bildung braucht einen Grund
Und wo bleiben dabei Deutsch und Mathematik? Menschen haben Sprache, Schrift und das Rechnen entwickelt, um miteinander umgehen zu können. Neugierige, soziale junge Menschen werden sich diese aus denselben Gründen aneignen. Gerne mit unserer Unterstützung und vor allem ohne Druck. „Die Bildung wird täglich geringer, weil die Hast größer wird“, klagte einst Friedrich Nietzsche. In diese Klage stimmen heute viele Eltern, Pädagog:innen und Lehrer:innen ein. Angesichts der hohen Lebenserwartung und in so einem reichen Land sollte es hier keinen Druck mehr geben. Vertrauen wir also dem inneren Bildungsmotor unserer Kinder und unterstützen sie.
Denn das Leben verstehen bedeutet Bildung heute
„Im Unterricht fragte die Lehrerin uns einst, was wir einmal werden wollen. Ich antwortete ,glücklich‘, woraufhin die Lehrerin meinte, ich hätte die Frage nicht verstanden. Ich antwortete darauf, sie hätte das Leben nicht verstanden.“ Diese Erinnerung stammt von John Lennon und niemand wird widersprechen wollen. Denn das Leben verstehen bedeutet Bildung heute.
Gernot Körner