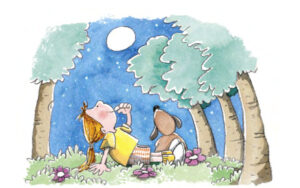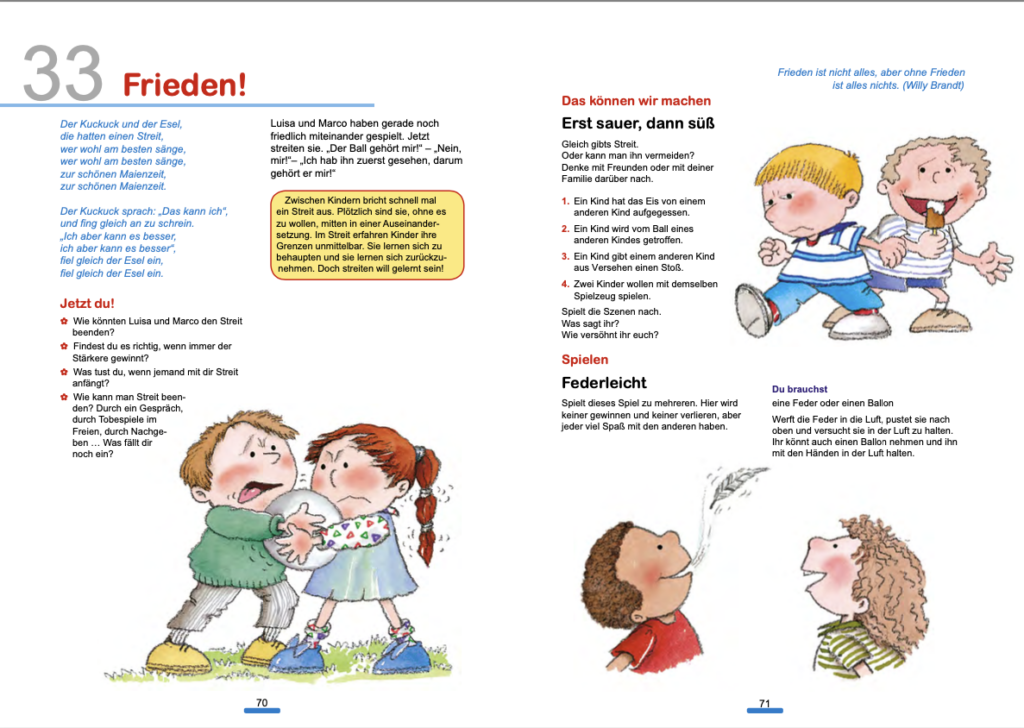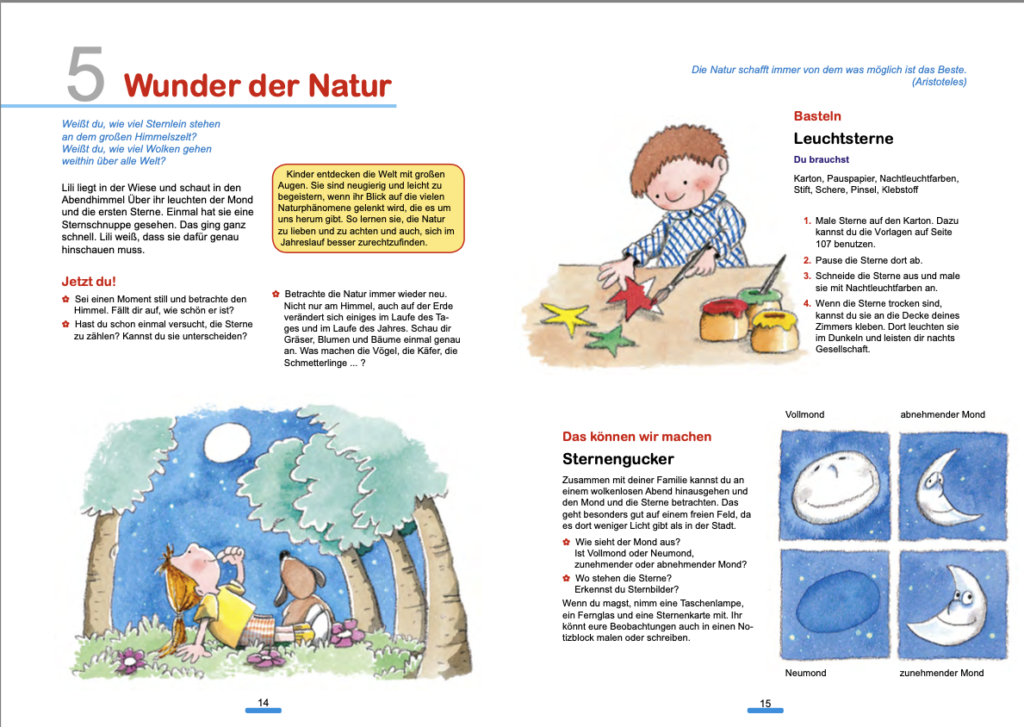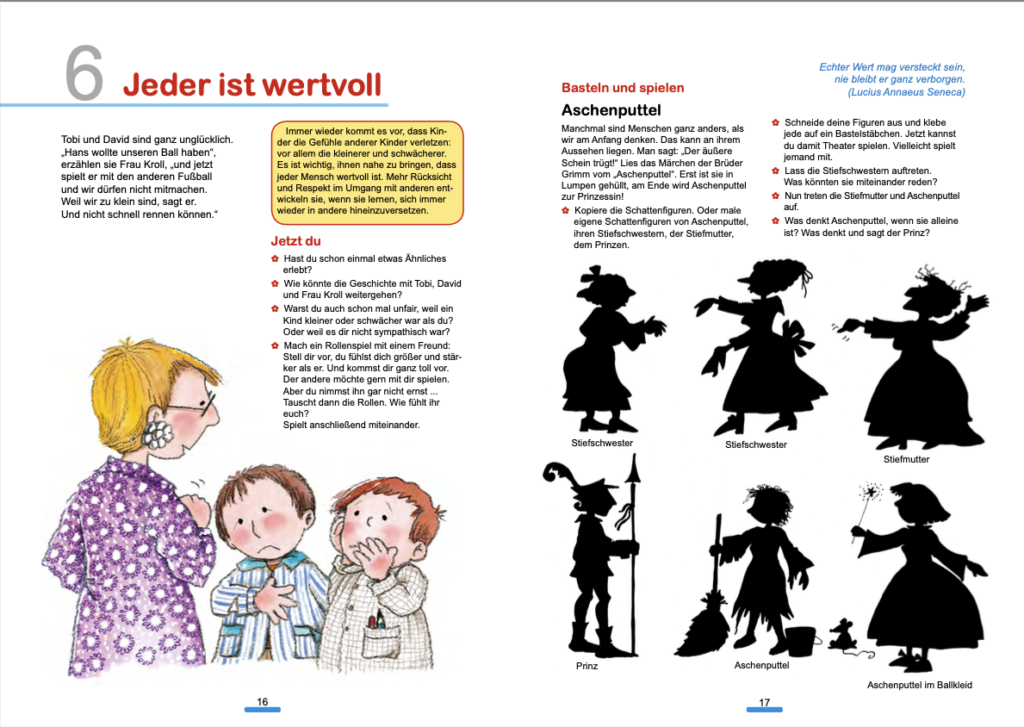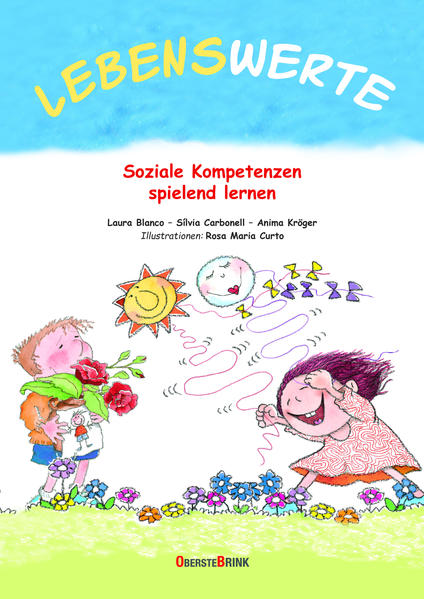Untersuchung internationaler Bildungspläne zeigt: Kognitive Leistung zählt mehr als soziale Entwicklung – mit weitreichenden Folgen
Programme zur frühkindlichen Bildung konzentrieren sich weltweit vor allem auf die Förderung kognitiver Fähigkeiten – soziale Kompetenzen und strukturelle Voraussetzungen hingegen finden in bildungspolitischen Leitlinien nur selten Berücksichtigung. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie unter Beteiligung der Technischen Universität München (TUM), der Universität Luxemburg und der Autonomen Universität Barcelona.
Das Forschungsteam analysierte über 90 offizielle Dokumente aus 53 Staaten, darunter nationale Bildungspläne, Leitlinien sowie Veröffentlichungen der Europäischen Union und der OECD. Ziel war es, ein globales Bild davon zu gewinnen, welche Werte und Zielsetzungen den Programmen zur frühen Bildung zugrunde liegen.
Im Zentrum: Sprache, Logik, Leistung
Die Ergebnisse zeigen deutlich: Im Mittelpunkt fast aller Programme stehen kognitive Fähigkeiten wie Sprache, Informationsverarbeitung oder mathematisch-räumliches Denken. Diese gelten als Schlüssel für schulischen und beruflichen Erfolg. Sozial-emotionale Kompetenzen wie Empathie, Konfliktfähigkeit oder Kooperationsbereitschaft werden dagegen nur in wenigen Ländern und in den Papieren internationaler Organisationen berücksichtigt.
Auch bei der Frage, wie Bildungserfolg zustande kommt, zeigt sich ein klares Muster: Die Programme betonen fast durchgängig individuelle Faktoren wie Anstrengung, Eigenverantwortung und Talent. Strukturelle Bedingungen wie das Einkommen oder der Bildungsstand der Eltern, belastende Lebensereignisse oder die Unterstützung durch das soziale Umfeld bleiben dagegen weitgehend außen vor.
Vernachlässigung mit gesellschaftlichen Folgen
„Die Vorstellung, dass Erfolg allein durch individuelle Leistung entsteht, greift zu kurz“, erklärt Studienleiter Prof. Dr. Samuel Greiff von der TUM. „Sie ignoriert, wie stark auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen den Bildungsweg eines Kindes beeinflussen.“ Besonders problematisch sei dies, wenn gleichzeitig die Förderung sozialer Kompetenzen vernachlässigt werde – also jener Fähigkeiten, die für demokratisches Zusammenleben, Teamfähigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt essenziell seien.
Der Befund wiegt schwer: Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung und wachsender Unsicherheit in vielen Gesellschaften ist die frühe Förderung von Toleranz, Respekt und sozialem Verständnis ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung demokratischer Kulturen. Der aktuelle Fokus vieler Programme auf individuelle Leistung könne dagegen unbeabsichtigt zu Konkurrenzdenken und einem verengten Bildungsverständnis führen – schon im Kita-Alter.
Bildungspolitik unter Wettbewerbsdruck
Laut dem Forschungsteam besteht zudem die Gefahr, dass der Trend zur Leistungsorientierung bereits in der frühen Bildung institutionellen Wettbewerb befeuert: Kindergärten und Kitas könnten sich gezwungen sehen, ihre Arbeit vorrangig auf messbare kognitive Leistungen auszurichten, während andere Bildungsziele ins Hintertreffen geraten.
„Wenn Programme soziale Kompetenzen ausblenden und strukturelle Benachteiligungen ignorieren, senden sie eine unausgewogene Botschaft – an Kinder, Fachkräfte und ganze Bildungssysteme“, so Greiff.
Die Studie ist unter dem Titel „The meritocracy trap: Early childhood education policies promote individual achievement far more than social cohesion“ im Fachjournal PLOS ONE erschienen.
Originalpublikation:
Bobrowicz K, Gracia P, Teuber Z, Greiff S (2025):
The meritocracy trap: Early childhood education policies promote individual achievement far more than social cohesion.
PLOS One 20(7): e0326021
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0326021
Kontakt für Rückfragen:
Prof. Dr. Samuel Greiff
Technische Universität München
Lehrstuhl für Educational Monitoring and Effectiveness
Tel.: +49 89 289 24214
E-Mail: samuel.greiff@tum.de